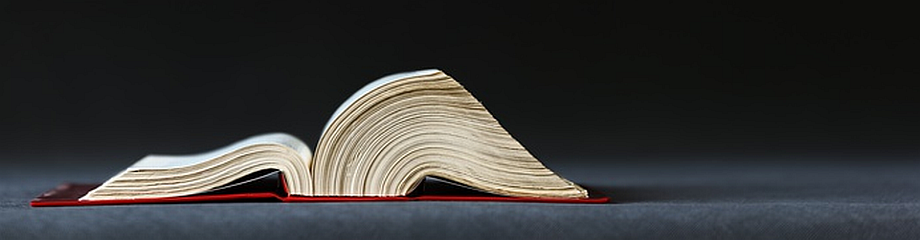Fachgutachten
Sozialrecht
Psychische Einschränkungen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben bzw. die Erwerbsfähigkeit
Nachfolgend sollen zunächst kurz die diesbezüglich relevanten Begrifflichkeiten (auch bezugnehmend auf die juristischen Termini) definiert werden: In den juristischen Termini wird Erwerbsfähigkeit als solche verstanden:
Eine Minderung der Erwerbsfähigkeit liegt vor, wenn durch das Vorliegen einer Krankheit oder Behinderung (s.o.) eine hierdurch kausal bedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit auf nicht absehbare Zeit vorliegt. Eine Rente wegen Erwerbsminderung, die auf die am 01.01.2001 in Kraft getretene Rentenreform zurückzuführen ist, sieht vor, dass in Abhängigkeit vom Ausmaß einer eingetretenen Leistungsminderung als Einkommensersatz eine Rente wegen teilweiser oder wegen voller Erwerbsminderung zu erfolgen hat.
Zur Feststellung einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderung wird die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben beurteilt. Dabei wird gemäß der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Leistung definiert als ein Konstrukt, das als Beurteilungsmerkmal angibt, was Personen in ihrer gegenwärtigen Umwelt tun. In Abgrenzung zum Begriff Leistung bezeichnet Leistungsfähigkeit (Kapazität) nach ICF ein Konstrukt, das als Beurteilungsmerkmal das höchstmögliche Niveau der Funktionsfähigkeit angibt, das eine Person in einer Domäne der Aktivitäten- und Partizipationsliste zu einem gegebenen Zeitpunkt erreicht bzw. erreichen kann. Leistungsfähigkeit spiegelt dabei die umwelt-adjustierte, bezogen auf die Berufsfähigkeit also die an die beruflichen Arbeitsbedingungen adjustierte Leistungsfähigkeit wider. Insofern geht die Beurteilung der Leistungsfähigkeit über eine einfache Beschreibung des allgemeinen Funktion- und Fähigkeitenniveaus (Aktivität und Partizipation) hinaus.
Bezugnehmend auf die Frage der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben im Zusammenhang mit psychischen Parametern liegen aus fachpsychologischer Sicht einerseits das jeweilige aktuelle Funktionsniveau, andererseits das Leistungsniveau zugrunde, das der/die Betroffene unter bestimmten kontextuellen (z.B. arbeitsplatzbezogenen) Bedingungen unter Berücksichtigung der vorliegenden psychischen Beeinträchtigungen realisieren kann.
Hierbei ist für das Verständnis der zugrunde liegenden Bewertungsmaßstäbe wichtig zu verstehen, dass die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben grundsätzlich von drei Variablengruppen abhängig zu sehen ist:
Zum einen müssen Art und Ausmaß psychischer und psychosomatischer Funktionen und Funktionsstörungen beurteilt werden. In die Bewertung einbezogen werden hierbei psychische Funktionen und Funktionsstörungen, die das klinische Erscheinungsbild aktuell und in der jüngeren Vergangenheit bestimmt haben. Sie können auf psychophysiologischer, emotionaler, kognitiver, verhaltensbezogener und interaktioneller Ebene beschrieben werden. Ebenso in die Beurteilung einzubeziehen sind Ressourcen, also Angaben über individuelle Fähig- und Fertigkeiten sowie Stärken, die geeignet sind, bestehende Funktionsminderungen zu kompensieren.
1. Die Beeinträchtigungen auf der psychischen und psychosomatischen Ebene sind weiter durch die Krankheitsverarbeitung beeinflusst, die insbesondere Aspekte des Leidensdrucks, des Krankheitskonzeptes, der Veränderungsmotivation und der Veränderungsressourcen umfasst.
2. Zentral für die Beurteilung er Leistungsfähigkeit sind die Aktivitäten und Fähigkeiten, die ein Individuum noch umsetzt oder prinzipiell noch umsetzen könnte. Die Bewertung der Aktivitäten und Fähigkeiten orientiert sich an der Beurteilung dessen, was Personen in ihrer tatsächlichen Umwelt tun.
Die psychologischen Empfehlungen ergeben sich im Hinblick auf die Bewertung der konkret vorliegenden (beruflichen) Leistungsfähigkeit entsprechend aus dem Abgleich der möglichen Aktivitäten und Fähigkeiten der/des Betroffenen mit dem beruflichen Leistungsprofil (sog. Partizipation).
Die berufliche Leistungsfähigkeit bzw. Erwerbsfähigkeit der/des Betroffenen wird dabei, in Anlehnung an die obig gemachten Erläuterungen, von der Art und dem Ausmaß psychischer und psychosomatischer Funktionen und Funktionsstörungen, der Art der Krankheitsverarbeitung sowie den zur Verfügung stehenden Aktivitäten und Tätigkeiten determiniert.
Gemäß der International Classification of Functioning (ICF; WHO 1998, deutsche Version 2002) bezeichnet der Begriff der Leistungsfähigkeit ein Konstrukt, das als Beurteilungsmerkmal das höchstmögliche Niveau der Funktionsfähigkeit angibt, das eine Person in einer Domäne der Aktivitäten- und Partizipationsliste zu einem gegebenen Zeitpunkt erreicht. Leistungsfähigkeit spiegelt die an die beruflichen Arbeitsbedingungen adjustierte Leistungsfähigkeit wider. Insofern geht die Beurteilung der Leistungsfähigkeit über eine einfache Beschreibung des allgemeinen Funktionsniveaus- und Fähigkeitsniveaus hinaus. Die Frage der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben gilt dem Leistungsniveau, das die betroffene Person unter bestimmten kontextuellen Bedingungen unter Berücksichtigung eventueller gesundheitlicher Beeinträchtigungen realisieren kann.
Bei der sozialpsychologischen und auch sozialmedizinischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben ist jedoch zu berücksichtigen, dass hierfür nicht die tatsächlich erbrachte oder unter optimalen bzw. standardisierten Bedingungen maximal erbringbare Leistung (Leistungsfähigkeit im Sinne der ICF, s.o.) ausschlaggebend ist, sondern die krankheits- oder behinderungsbedingte zumutbare Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben, bei der z.B. auch krankheitsbedingte Gefährdungs- und Belastungsfaktoren im Arbeitsalltag entsprechend zu berücksichtigend sind. Demzufolge steht hier die Leistungsfähigkeit mit den funktionellen Einschränkungen durch Krankheits- und Behinderungsfolgen vor dem Hintergrund der beruflichen Belastungs- und Gefährdungsfaktoren und deren Kompensationsmöglichkeiten im Mittelpunkt der Beurteilung.