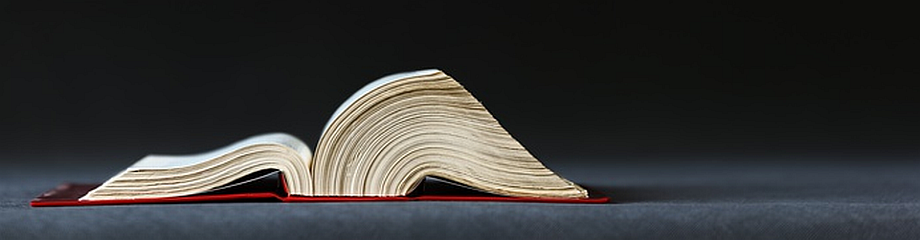Fachgutachten
SOZIALRECHT
Bezugnehmend auf die Begutachtung der Erwerbsfähigkeit im sozialrechtlichen Sinne, d.h. der gutachterlichen Beurteilung des erwerbsbezogenen Leistungsvermögens, ist dementsprechend eine spezifische, sehr konkrete und auch differenzierte Untersuchung der krankheits- bzw. behinderungsbedingten Zustände physischer und/ oder psychischer Einschränkungen, die die Fähigkeit eines Menschen beeinträchtigen, seinen Lebensunterhalt durch Ausübung einer beruflichen Tätigkeit zu verdienen, erforderlich.
Hierbei ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsfähigkeit nicht direkt aus der somatischen, psychischen oder psychosomatischen Erkrankung bzw. Diagnosestellung als solche herleitet. Die konkrete Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben ist vielmehr als abhängig zu sehen von drei krankheitsbezogenen Variablengruppen, hier vor dem Hintergrund der jeweils bei den betroffenen Patienten spezifischen Symptomatik (s.u.), insbesondere auf den Bereich der psychischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen bezogen (gemäß Leitlinie zur Begutachtung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen): Zum einen müssen die spezifischen, einzelfallbezogenen Ausprägungen der psychischen und psychosomatischen Funktionen und Funktionsstörungen (Art und Ausmaß) erfasst werden. Hiermit sind solche psychischen Funktionen und Funktionsbeeinträchtigungen gemeint, die für das klinische Erscheinungsbild relevant sind, aktuell und in jüngerer und vorgeschichtlicher Vergangenheit. Sie können auf psychophysiologischer, emotionaler, kognitiver, verhaltensbezogener und interaktioneller Ebene vorliegen.
In diese Kategorie fallen beispielsweise die konkreten Symptome und der Schweregrad einer psychischen Erkrankung. Ebenso von Bedeutung sind hier jedoch auch Ressourcen, also Angaben über individuelle Fähig- und Fertigkeiten, die geeignet sind, bestehende Funktionsminderungen (negatives qualitatives Leistungsvermögen, s.o.) zu kompensieren. Die psychischen Funktionen und gegebenenfalls ihre Einschränkungen (z. B. Emotionalität, kognitive Prozesse, Verhaltens- und interaktionelle Prozesse) sollten möglichst konkret und umfassend beschrieben werden.
Weiterhin hat sich gezeigt, dass die jeweilige Krankheitsverarbeitung Einfluss auf die (berufsbezogene) Leistungsfähigkeit hat. Diese beinhaltet insbesondere Aspekte des Leidensdruckes (subjektiver Schweregrad), des Krankheitskonzeptes (z.B. somatisches oder psychisches Erkrankungsmodell), der Veränderungsmotivation und der Veränderungsressourcen. Diese Variablen, die sich auch abhängig von funktionalen oder dysfunktionalen psychischen und/oder psychosomatischen Einschränkungen und Ressourcen zeigen, sind beispielsweise im Hinblick auf die prognostische Einschätzung des weiteren Verlaufs (z.B. erwartete Chronifizierung, Verbesserung oder Verschlechterung) von hoher Relevanz, so dass sie bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben berücksichtigt werden sollten.
Ebenfalls relevant für die Beurteilung der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit sind die Aktivitäten und Fähigkeiten, die ein Individuum noch umsetzt oder prinzipiell noch umsetzen könnte (positives qualitatives Leistungsvermögen, s.o.).
Zur Bewertung relevanter Aktivitäten und Fähigkeiten eines Individuums werden alle berufsrelevanten Aktivitäten und Funktionen als Bezugsrahmen herangezogen. Bei der Beschreibung und der Bewertung der Aktivitäten/Fähigkeiten wird diesseits auf die diesbezüglichen Kategorien des Mini-ICF-APP (Mini-ICF-Rating für Aktivitäts- und Partizipationsstörungen bei psychischen Erkrankungen; Linden et al., 2009) Bezug genommen. Diese stellen Funktions- und Fähigkeitsbereiche heraus, die für die allgemeine und auch insbesondere für die berufliche Leistungsfähigkeit relevant sind. Hierzu gehören u.a. folgende Bereiche: Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen, Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von Aufgaben, Flexibilität und Umstellungsfähigkeit, Fähigkeit zur Anwendung fachlicher Kompetenzen, Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, Durchhaltefähigkeit, Selbstbehauptungsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstpflege und Wege- / Verkehrsfähigkeit.