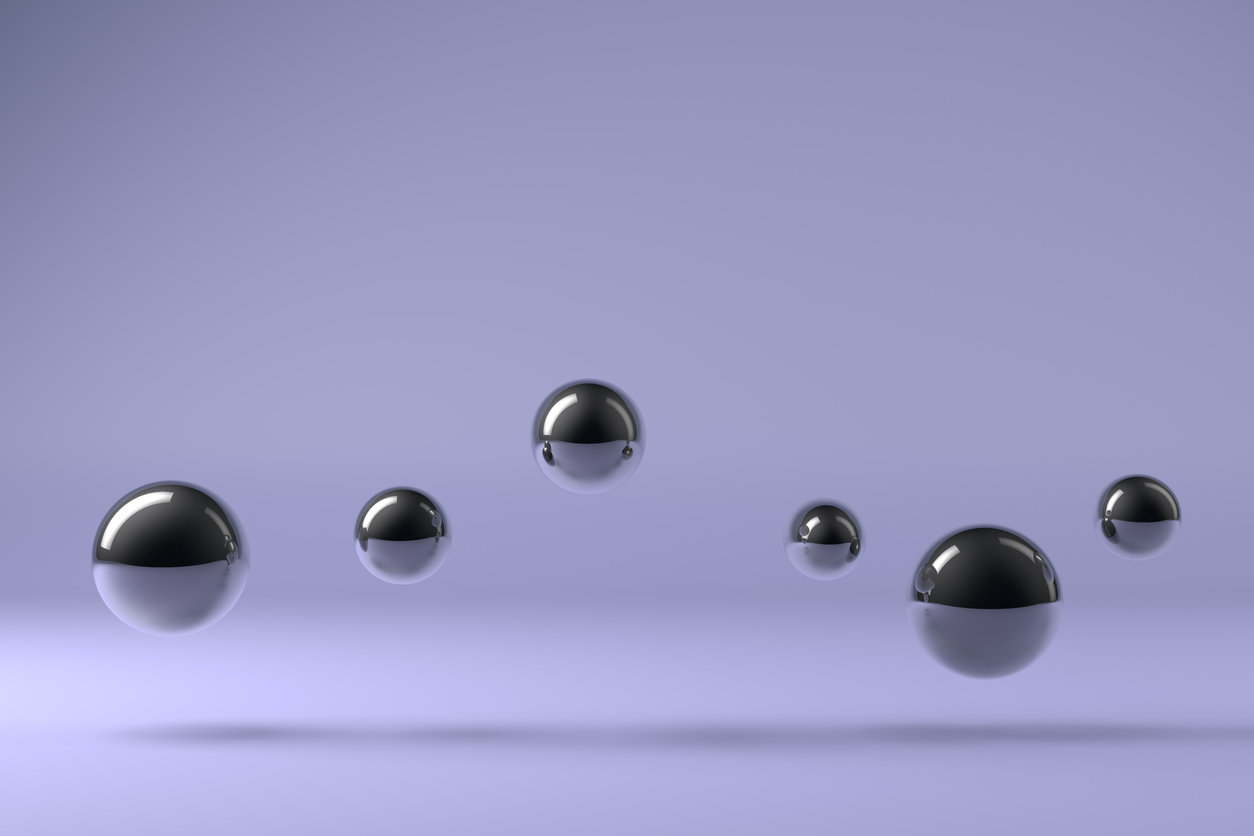VG München (12. Kammer), Urteil vom 25.06.2015 - M 12 K 14.2038
Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung als Dienstunfall
BayBeamtVG Art. 46 Abs. 1 S. 1
Redaktionelle Leitsätze:
1. Ein äußeres, den Dienstunfall verursachendes Ereignis kann nicht nur ein physisch auf den Körper des Beamten einwirkendes Ereignis sein, sondern auch ein solches, das nur mittelbar krankhafte Vorgänge im Körper auslöst, etwa durch die Verursachung eines seelischen Schocks.
2. Unter einem Körperschaden im Sinne des Dienstunfallrechtsist jede über Bagatelleinbußen hinausgehende Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität zu verstehen, mithin auch eine als Folge einer Traumatisierung eingetretene seelische Erkrankung.
3. Die Feststellung eines traumatisierenden Ereignisses ist Grundvoraussetzung für die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstötrung (PTBS). Ein Rückschluss vom Krankheitsbild einer PTBS auf ein traumatisches Erlebnis genügt diesen Anforderungen nicht.
4. Die Anwendung des Klassifizierungssystems DSM-5 anstelle des Klassifizierungssystems ICD-10 widerspricht den derzeit in Deutschland geltenden fachlichen Grundsätzen der medizinischen Fachgesellschaften, wonach die Diagnostik der PTBS anhand der klinischen Kriterien ICD-10 erfolgen soll.
5. Ein Ursachenzusammenhang kann nur angenommen werden, wenn der behauptete schädigende Vorgang seiner Art nach generell geeignet ist, die geltend gemachten emotionalen Belastungen mit Krankheitswert hervorzurufen.
In dem Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 25. Juni 2015 (Az. M 12 K 14.2038) ging es um die Frage, ob eine beamtliche Lehrerin, die im Januar 2011 von einem gewalttätigen Schülerstreit an ihrer Volksschule hörte, Anspruch auf Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) als Dienstunfallfolge hat.
Nach Artikel 46 Absatz 1 Satz 1 des Bayerischen Beamtengesetzes ist ein Dienstunfall ein äußeres, plötzliches und bestimmbares Ereignis, das in Ausübung oder als Folge des Dienstes einen Körperschaden verursacht. Ein Körperschaden erfasst dabei nicht nur körperliche Verletzungen, sondern auch seelische Beeinträchtigungen, sofern sie über Bagatelleinbußen hinausgehen und ursächlich auf dem Unfall beruhen. Entscheidend ist insoweit, dass der Dienstunfall wesentliche Ursache für den Körperschaden war; Ereignisse, die nur „den Tropfen darstellen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, gelten als Gelegenheitsursachen und rechtfertigen keine Unfallversorgung.
Die Klägerin hatte nach eigenem Vortrag den Ärztinnen und Ärzten gegenüber angegeben, sie sei Zeugin einer heftigen Auseinandersetzung geworden, bei der mehrere Zweitklässler einen Drittklässler mit einer Flasche attackierten. Ihr Anwalt legte daraufhin ein Gutachten eines Psychotherapeuten vor, das bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-10 F 43.1 diagnostizierte und diese als Folge des Schülerstreits einstufte. Weitere Atteste von Neurologen und Psychiatern bestätigten eine PTBS und eine mittelschwere depressive Episode.
Das Gericht verwies jedoch darauf, dass eine PTBS nach den verbindlichen klinischen Kriterien des ICD-10 die Voraussetzung eines Ereignisses „von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophenartigem Ausmaß“ erfordert, bei dem „nahezu bei jedem“ Betroffenen eine tiefe Verzweiflung auslöst. Allein das Hören von einer Auseinandersetzung unter Grundschülern, bei der niemand verletzt wurde, erfülle diesen objektiven Maßstab nicht. Die Lehrerin war nämlich keine direkte Zeugin noch Opfer einer schweren Gewalttat, vielmehr hatte sie erst nachträglich von dem Streit erfahren; das betroffene Kind selbst konnte sich nach wenigen Tagen nicht mehr erinnern. Selbst die Befragung durch die Amtsärztin ergab keine plausible Schilderung eines Verletzungs- oder Lebensgefährdungsszenarios.
Darüber hinaus klagten die behandelnden Ärzte in ihren Stellungnahmen über eine Vorgeschichte früherer Konflikte und eine fehlende Unterstützung durch die Schulleitung, wodurch das Trauma womöglich verstärkt worden sei. Diese keine Ausnahme darstellenden innerdienstlichen Probleme – gleichwohl belastend – führten jedoch nicht zu einem Körperschaden im Sinn des Dienstunfallrechts, weil sie nicht die erforderliche Einmaligkeit und Erheblichkeit eines Dienstunfalls aufwiesen.
Aus all diesen Gründen gelangte das VG München zu dem Ergebnis, dass die Klägerin weder eine Posttraumatische Belastungsstörung noch eine depressive Episode als wesentliche Folge eines Dienstunfalls nachweisen konnte. Die Klage wurde daher abgewiesen und die Kosten der Klägerin auferlegt. Dieses Urteil bekräftigt den Grundsatz, dass psychische Erkrankungen nur dann als Dienstunfall anerkannt werden können, wenn die objektiven und klinischen Voraussetzungen eines schweren traumatischen Ereignisses erfüllt und dessen kausaler Zusammenhang mit der Krankheitsentwicklung nachgewiesen sind.