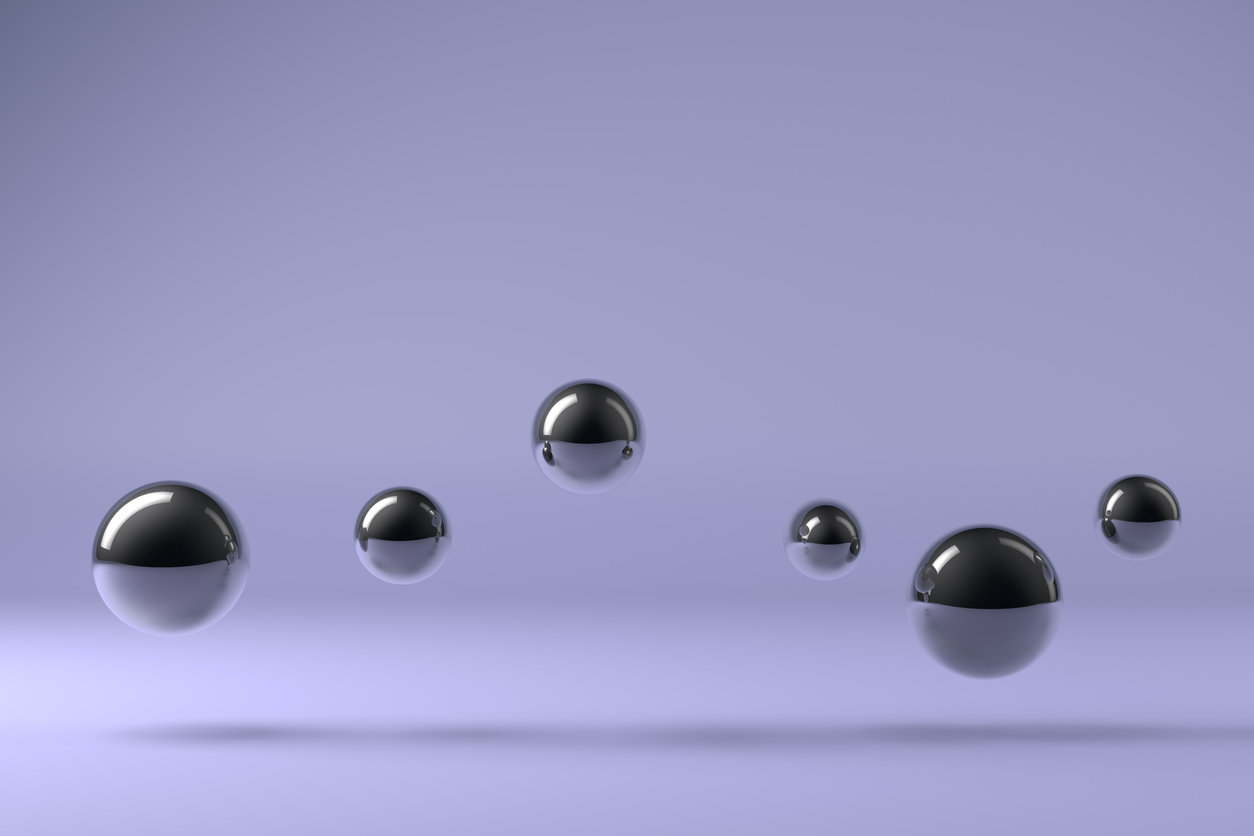BGH, Beschl. v. 24.1.2018 – XII ZB 141/17 z. Einwilligungsvorbehalt bei
ungewisser Geschäftsunfähigkeit
BGB §§ 1901 Abs. 3 S. 1, 1903 Abs. 1 S. 1
Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 14. März 2017 (VI ZR 225/16) die Anforderungen darlegen, die eine Partei erfüllen muss, wenn sie sich auf ihre eigene Geschäftsunfähigkeit beruft, und zugleich klargestellt, wie das Gericht im Beschwerdeverfahren mit einem entsprechender Beweisangebot umzugehen hat.
Der Kläger hatte geltend gemacht, aufgrund einer seit 1995 bestehenden seelischen Erkrankung nicht mehr in der Lage zu sein, seine finanziellen Angelegenheiten eigenständig zu regeln, und forderte von seinem ehemaligen Vermieter die Rückzahlung unberechtigt abgebuchter Beträge. Nachdem das Landgericht in erster Instanz die Klage abgewiesen und das Berufungsgericht die Entscheidung bestätigt hatte, wandte sich der Kläger mit Nichtzulassungsbeschwerde an den BGH. Er hatte sowohl seinen konkreten Vortrag zu monatelangen „Ausnahmezuständen“ und „handlungsunfähigen Phasen“ durch Vorlage eines Berichts des sozialpsychiatrischen Dienstes dargelegt als auch die Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens angeboten.
Der BGH hob das Berufungsurteil auf, weil die Kammer rechtsfehlerhaft den Vortrag des Klägers zur Geschäftsunfähigkeit als unsubstantiiert verwarf und das angebotene Gutachten pauschal als „Ausforschung“ abgelehnt hatte. Art. 103 Abs. 1 GG gebietet, dass das Gericht alle entscheidungserheblichen Tatsachen in der Beweisaufnahme klärt, wenn die Partei sie plausibel vorträgt. § 104 Nr. 2 BGB setzt für einen Ausschluss der freien Willensbestimmung voraus, dass der Betroffene infolge seiner Geistesstörung nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen frei und unbeeinflusst zu bilden, etwa weil fremde Einflüsse diesen beherrschen. Erforderlich ist eine schlüssige Darstellung konkret erlebter und anerkannter Symptome, nicht allein ein vager Hinweis auf „Hilflosigkeit“.
Der Senat betont, dass allein die Behauptung einer unsicheren Geschäftsfähigkeit nicht zur Anordnung eines ärztlichen Gutachtens berechtigt; vielmehr muss der Parteivortrag selbst die Schwelle zur Geschäftsunfähigkeit plausibel erreichen. Ist diese Schwelle jedoch durch substantiierten Vortrag übersprungen, darf das Gericht das Beweismittelangebot – hier ein psychiatrisches Gutachten – nicht unbegründet abweisen, sondern muss in die Begutachtung eintreten.
Schließlich erinnerte der BGH daran, dass das Gericht nach § 51 Abs. 1 ZPO von Amts wegen die Prozessfähigkeit der Parteien klären muss. Eine mangelnde Geschäftsfähigkeit schließt das Berufungsrecht nicht aus, erfordert jedoch im Falle einer tatsächlichen Unfähigkeit die Bestellung eines Vertreters.
Durch die Zurückverweisung an das Berufungsgericht hat der BGH sichergestellt, dass der Kläger seine Geschäftsunfähigkeit in einer erneuten, rechtlich ordnungsgemäßen Beweisaufnahme nachweisen kann. Das Gericht muss nun – unter Beachtung des strengen Gehörsgebots und des rechtlichen Maßstabs des § 104 Nr. 2 BGB – entscheiden, ob der Kläger tatsächlich nicht mehr in der Lage war, frei und schuldfrei zu disponieren, und ob daher ein Rückforderungsanspruch gegenstanden dürfte.