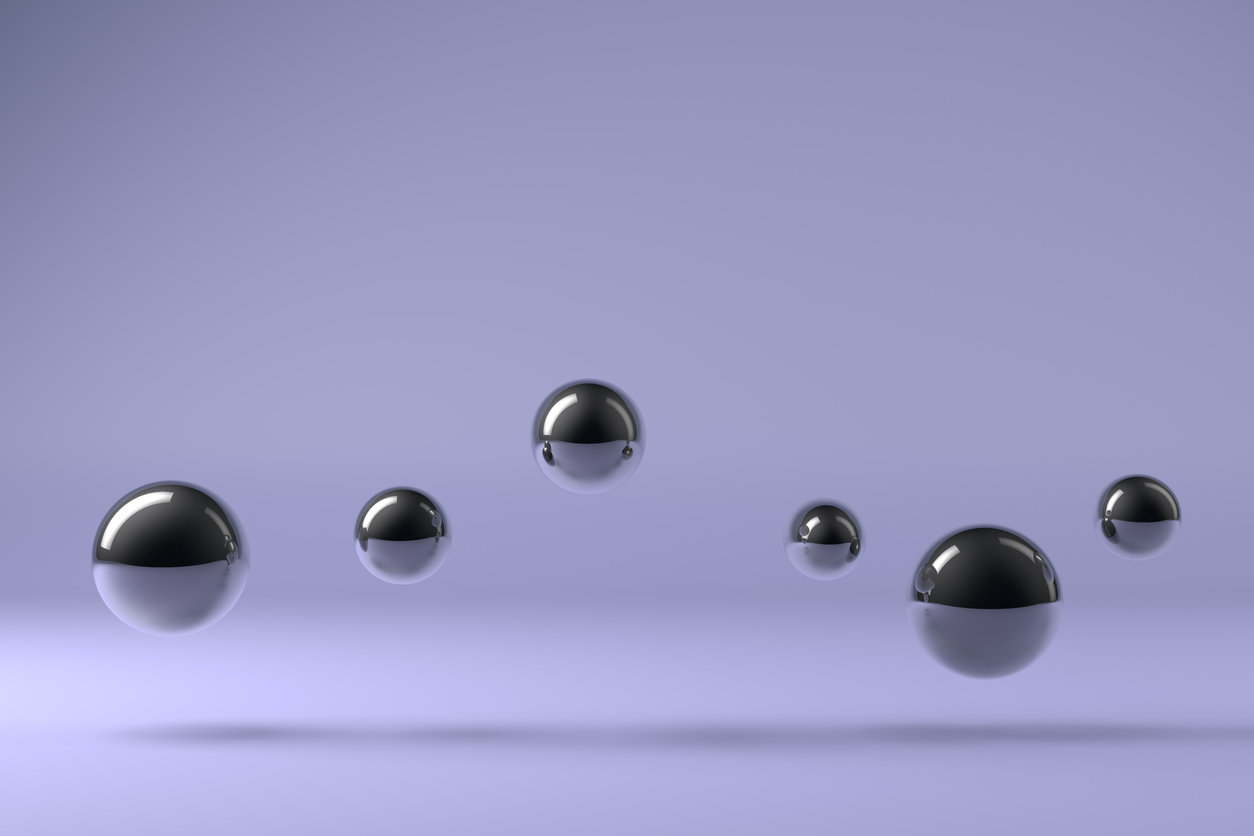Pflegeeltern können Rückführung nur bei unmittelbarem zeitlichen Zusammenhand zur Herausnahme verlangen
BGB § 1632 Abs. 1, Abs. 4, § 1666, § 1666a
Pflegeeltern können eine Rückführung des Pflegekindes nach § 1632 IVBGB nur dann beanspruchen, wenn zwischen der Herausnahme des Kindes aus ihrem Haushalt und der Einleitung des Verfahrens auf Anordnung des Verbleibs ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang besteht. (amtlicher Leitsatz)
BGH, Beschluss vom 16.11.2016 – XII ZB 328/15, BeckRS 2016, 20744 (OLG Hamm, Beschluss vom 03.07.2015 – II-5 UF 198/14)
Die vom Oberlandesgericht bestätigte fortdauernde Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts erweist sich, gemessen an den §§ 1666, 1666 a BGB i. V. m. § 1696 Abs. 2 BGB, als weiterhin erforderlich und verhältnismäßig. Ausgangspunkt ist, dass die Aufrechterhaltung einer derart gravierenden Maßnahme nur legitim ist, wenn eine aktuelle Kindeswohlgefährdung besteht, die sich mit der Rückführung des Kindes in den elterlichen Haushalt verwirklichen würde. Nach den verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Oberlandesgerichts liegt eine solche Gefahr vor, weil beide Eltern aufgrund erheblicher kognitiver, sozial-emotionaler und erzieherischer Defizite nicht in der Lage sind, die besonderen Förder- und Betreuungsbedürfnisse ihres entwicklungsverzögerten Sohnes angemessen zu decken.
§ 1666 Abs. 1 BGB verpflichtet das Familiengericht, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Eltern außerstande sind, diese Gefahr abzuwenden. Hierzu zählt – als ultima ratio – auch die Entziehung einzelner Sorgekomponenten, insbesondere des Aufenthalts- und Umgangsbestimmungsrechts. Bei der Anwendung dieses § 1666 BGB ist der verfassungsrechtliche Rang des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG strikt zu berücksichtigen; der staatliche Eingriff muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeitgenügen und sich als das mildeste noch effektive Mittel darstellen. Das Oberlandesgericht hat nachvollziehbar dargelegt, dass umfangreiche, mehr als anderthalb Jahre währende ambulante Hilfen (sozialpädagogische Familienhilfe von 26 Wochenstunden, Tagesgruppenbetreuung) gescheitert sind, weil die Eltern eine konstruktive Mitarbeit verweigerten. Damit waren - im Sinne des § 1666 a Abs. 1 S. 1 BGB - sämtliche weniger einschneidenden Alternativen ausgeschöpft.
Die Würdigung der einschlägigen Diagnosen (globale Entwicklungs- und Sprachentwicklungsverzögerung, frühe tiefgreifende Bindungsstörung, ausgeprägte Stresssymptome) zeigt, dass das Kind ohne fachlich angeleitete Einzelbetreuung fortlaufend unter erheblichen Gefährdungen leidet. Eine Rückführung in die elterliche Obhut würde die bereits eingetretenen Schädigungen nicht nur perpetuieren, sondern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vertiefen. Zugleich hat das Oberlandesgericht zutreffend darauf hingewiesen, dass das staatliche Wächteramt nach Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG nicht auf die bestmögliche Förderung zielt, sondern auf die Abwehr schwerwiegender Gefahren für das Kind; diese Schwelle ist hier überschritten.
Die Trennung des Kindes von seiner Herkunftsfamilie bleibt deshalb – trotz des schwerwiegenden Eingriffs – gerechtfertigt. Dass die Gerichte ihre Aufklärungspflicht in besonderem Maße erfüllt haben, belegt die umfassende Verwertung sachverständiger Einschätzungen, der Berichte des pädagogischen Fachpersonals sowie der Stellungnahmen von Verfahrensbeistand und Ergänzungspflegerin. Eine erneute psychologische Begutachtung war nicht geboten, da keine Veränderung der elterlichen Disposition vorgetragen oder sonst ersichtlich war.
Schließlich begegnet auch die gesonderte Entziehung des Umgangs- und Jugendhilfebestimmungsrechts keinen Bedenken. Ohne diese flankierenden Maßnahmen bestünde die konkrete Gefahr, dass die Eltern die gerichtlich normierte Umgangsregelung unterlaufen und den Sohn erneut erheblichem Loyalitätsdruck aussetzen. Die Entscheidung ist mithin geeignet, erforderlich und auch im engeren Sinne verhältnismäßig, weil mildere Instrumente – etwa eine bloße gerichtliche Umgangsregelung oder eine Umgangspflegschaft – angesichts der fortbestehenden mangelnden Kooperationsbereitschaft der Eltern nicht ausreichen würden, den Kindeswohlgefährdungen wirksam entgegenzutreten. Folglich bleibt die Entziehung des Aufenthalts-, Umgangs- und Jugendhilfebestimmungsrechts nach §§ 1696 Abs. 2, 1666, 1666 a BGB geboten.
Praxishinweis
Die Entscheidung würdigt die Funktion der Pflegefamilie als Ersatzfamilienverbund auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht, hebt jedoch die grundsätzliche qualitative Bedeutung in Abgrenzung zu dem tatsächlichen Elternrecht hervor. Im konkreten Fall wäre eine rechtzeitige Entscheidung der Pflegemutter zum beabsichtigten weiteren Vorgehen erforderlich und insbesondere auch durch das Kindeswohl geboten gewesen.