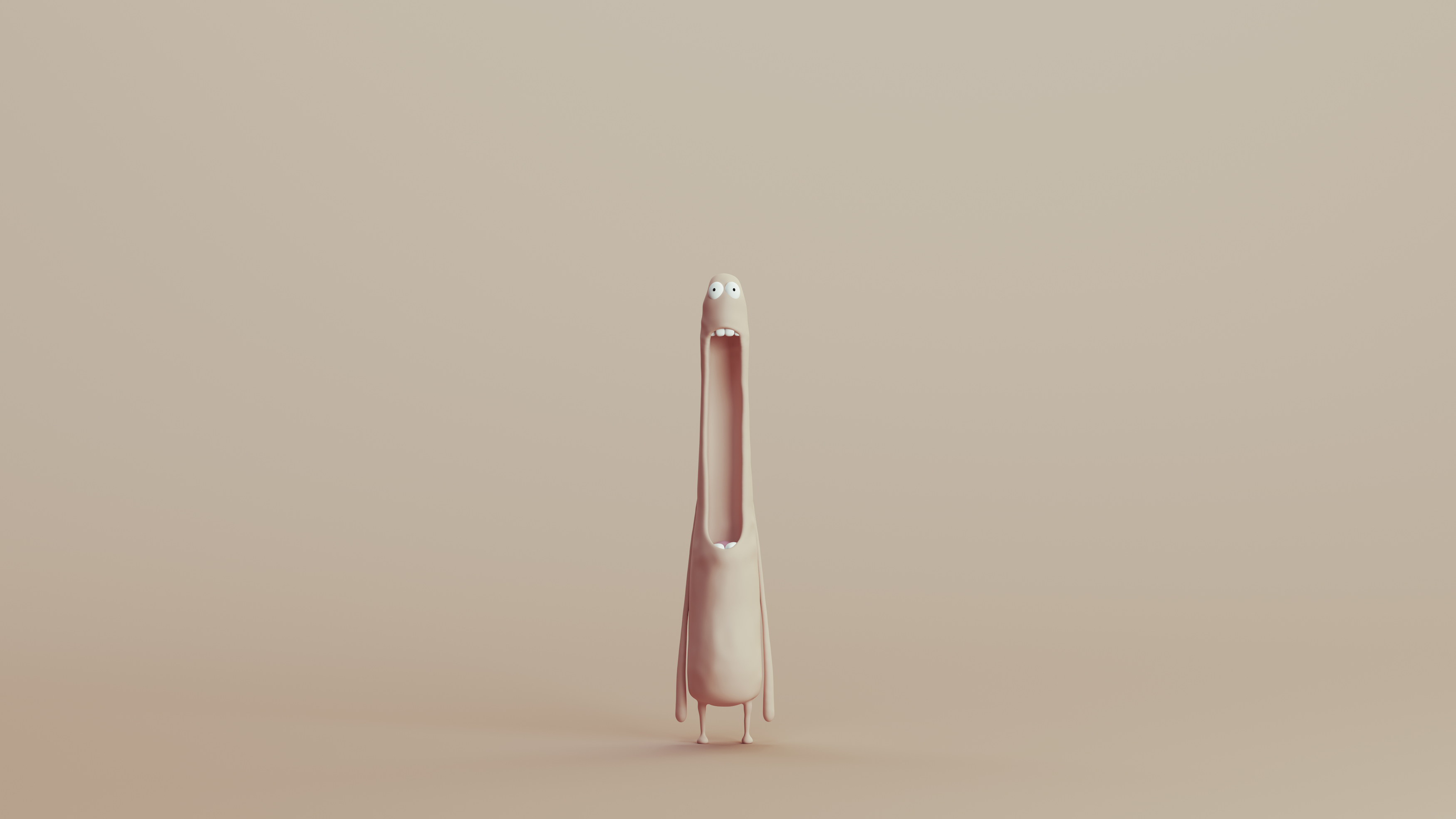Die Reifung des sozialen Gehirns
Im Laufe der Kindheit lassen sich markante Veränderungen des Sozialverhaltens beobachten. Zunächst dominieren Egozentrik und geringe Frustrationstoleranz; mit fortschreitendem Alter nimmt jedoch die Prosozialität deutlich zu. Neurowissenschaftliche Studien zeigen inzwischen, dass diese Verhaltensverschiebung mit der Reifung jener Hirnregionen zusammenhängt, die für Impulskontrolle zuständig sind. Je ausgereifter diese Areale werden, desto eher können Kinder in Konfliktsituationen zugunsten gemeinsamer Normen handeln, anstatt spontanen Eigeninteressen zu folgen.
Ein illustratives Beispiel liefert der Spielplatz: Wird einem Kind ein Spielzeug entrissen, reagiert es meist mit Weinen und einem impliziten Ruf nach Unterstützung. Während solche Szenen im Vorschulalter häufig auftreten, werden sie bei älteren Kindern seltener – offenbar, weil das wachsende Gerechtigkeitsempfinden zunehmend regulierendes Verhalten begünstigt. Experimente zeigen, dass Sechs- bis Dreizehnjährige bereitwilliger wertvolles (Spiel-)Geld mit unbekannten Peers teilen und ihre Teilungsstrategien anpassen, wenn die Gegenseite ein Vetorecht besitzt.
Um die neuronal-kognitiven Mechanismen hinter dieser Entwicklung zu beleuchten, führten Forschende am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften ökonomische Spielparadigmen – darunter das Diktator- und das Ultimatumspiel – mit Grundschulkindern durch. Parallel wurde mittels funktioneller MRT untersucht, welche Hirnareale während der Entscheidungen aktiv waren. Besonders deutlich zeigte sich eine altersabhängige Zunahme der Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC) – linke wie rechte Hemisphäre – genau dann, wenn Kinder strategisch handelten. Der linke DLPFC wies nicht nur eine stärkere Funktion, sondern auch eine größere kortikale Dicke bei jenen Kindern auf, die besonders raffinierte Verteilungsentscheidungen trafen – unabhängig vom Alter.
Die Ergebnisse deuten auf einen Reifungsprozess hin, bei dem späte strukturelle und funktionelle Entwicklung des DLPFC für den Übergang zu reiferem Sozialverhalten zentral ist. Gleichzeitig könnten individuelle Unterschiede im DLPFC – genetisch bedingt oder durch Übung erworben – erklären, warum Kinder sich in ihrer sozialen Strategie unterscheiden. Insgesamt stützt die Befundlage die Annahme, dass Fortschritte in der Impulskontrolle und in den zugehörigen frontalen Netzwerken maßgebliche Treiber prosozialer Entwicklung sind. Dieses Wissen eröffnet Möglichkeiten, schon früh interventionell anzusetzen, um sozial adaptives Verhalten gezielt zu fördern.