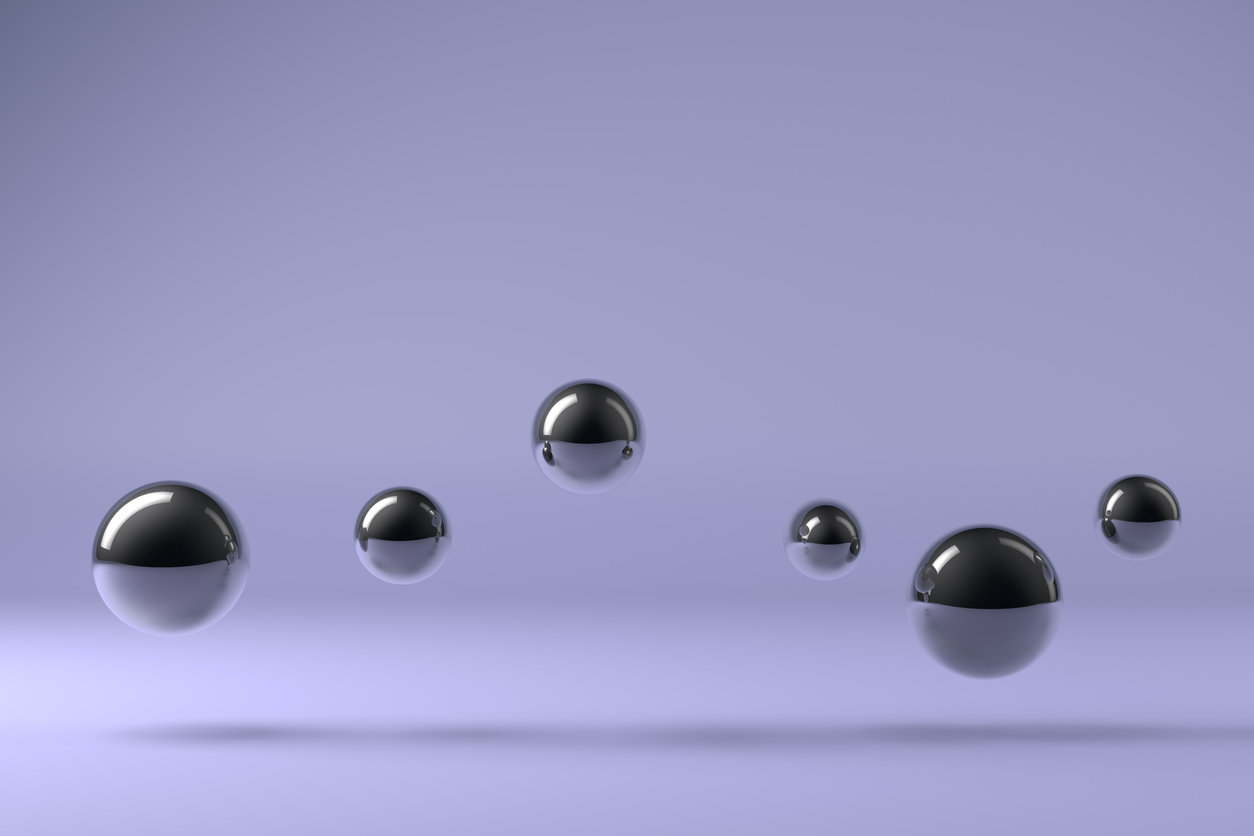OLG Stuttgart, Beschluss vom 29.7.2015 – 16 UF 117/15
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat mit Beschluss vom 29. Juli 2015 (Az. 16 UF 117/15) entschieden, dass die Mutter – trotz fehlender Zustimmung des Vaters – befugt ist, für ihre minderjährigen Kinder den Antrag auf Namensänderung gemäß § 3 NamÄndG bei der zuständigen Behörde zu stellen.
Hintergrund ist eine Härtefallscheidung der Eltern im Jahr 2014, bei der das Familiengericht eine gemeinsame elterliche Sorge beibehielt, die Mutter aber ihren Geburtsnamen zurücknehmen durfte. Nun beantragt sie für die drei- und einjährigen Kinder ebenfalls die Rückkehr zum Mädchennamen, da diese unter der traumatischen Gewalterfahrung der Mutter und dem fehlenden Umgangskontakt zum Vater erheblich litten. Da der Vater seine Zustimmung verweigert, stellte sich die Frage, ob die Entscheidungsbefugnis nach § 1628 BGB allein auf die Mutter übertragen werden könne.
Das OLG verneinte zunächst eine Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften zur Namensführung (§§ 1617b, 1617c BGB) und betonte, dass es sich um ein öffentlich-rechtliches Verfahren nach dem Namensänderungsgesetz handele. Bei minderjährigen Kindern müsse der Antrag zwar grundsätzlich von beiden Eltern gemeinsam gestellt werden, doch könne das Familiengericht gemäß § 1628 BGB einem Elternteil allein die Entscheidung übertragen, wenn der andere Elternteil seine Zustimmung unberechtigt verweigert und nicht nur geringfügige Erfolgsaussichten für den beantragten Verwaltungsakt ersichtlich sind.
Das OLG führte aus, dass im Rahmen der summarischen Prüfung weder die gesamte materielle Rechtmäßigkeit des Antrags zu prüfen sei noch ein strenger Beurteilungsmaßstab wie 2010 praktiziert (NJW-RR 2011, 222) heranzuziehen, sondern es genüge, wenn nicht bereits offenkundige Aussichtslosigkeit besteht. Lediglich in Extremfällen, in denen die Namensänderung aus rein subjektiven Motiven völlig ins Leere läuft, könne eine Übertragung unterbleiben.
Im Übrigen stellte das OLG ausdrücklich klar, dass im Verfahren nach dem NamÄndG – wie schon im Rahmen von § 1618 S. 4 BGB – Kindeswohlkriterien entscheidend sind. Dabei können etwa jene Gesichtspunkte eine Rolle spielen, die das OLG hier als gewichtige Gründe ansah:
- erstens die Ausstrahlungswirkung der Gewalterfahrung der Mutter auf das seelische Befinden der Kinder,
- zweitens das Fehlen regelmäßiger Umgangskontakte zum Vater und damit die Gefahr einer fehlenden Bindungsbildung.
Gleichzeitig warnte das Gericht davor, eine Namensänderung nicht als Belohnung einer willentlichen Umgangsbehinderung zu verstehen. Vielmehr müsse das Familiengericht im Hauptverfahren eine Abwägung vornehmen, ob die beantragte Namensänderung dem Maßstab “Erforderlichkeit zum Wohl des Kindes” entspricht. Nur wenn eine Namensänderung aus Kindeswohlsicht unverzichtbar ist, darf die Übertragungsentscheidung der Mutter Bestand haben.