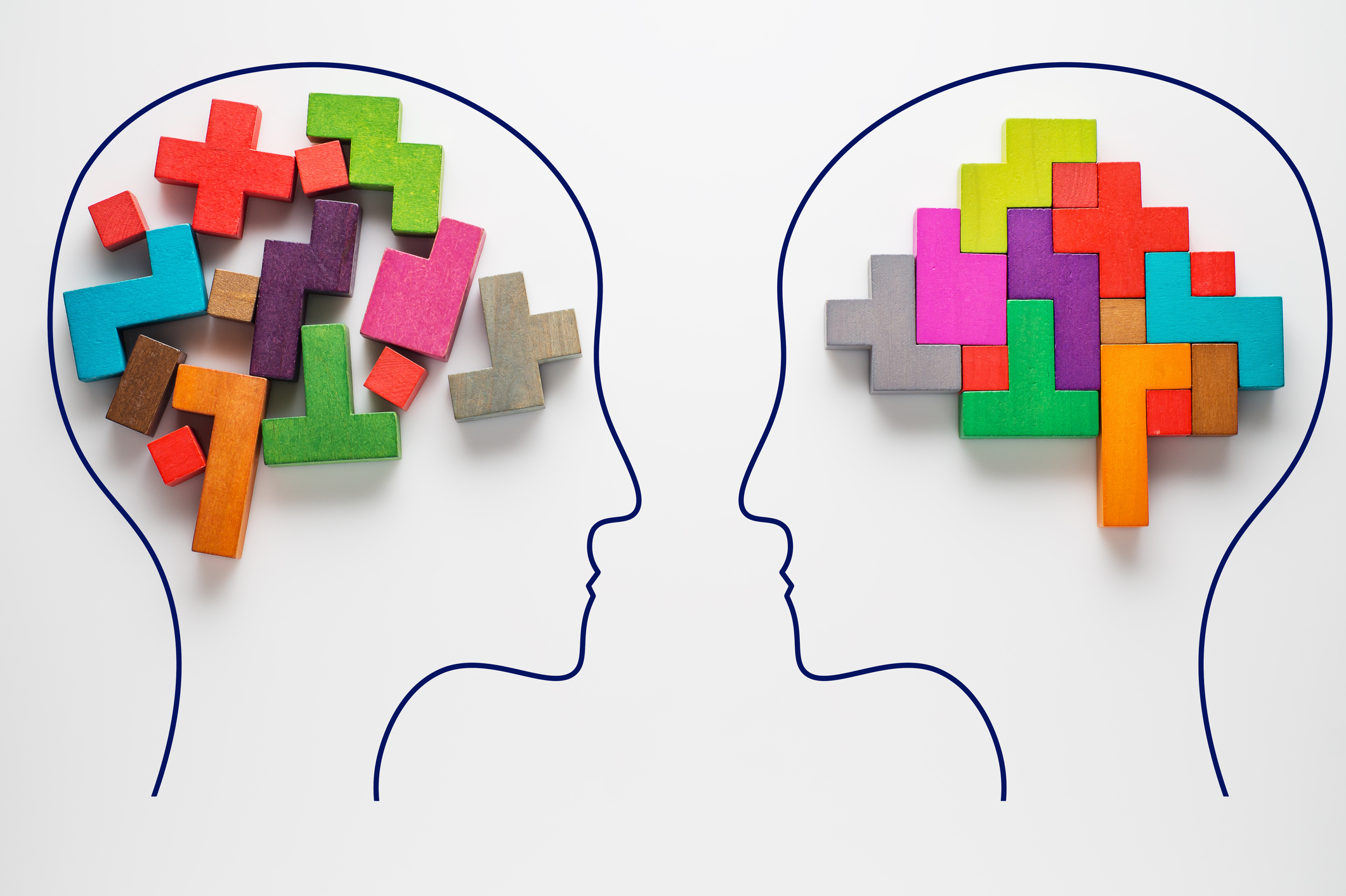Psychologische Fachgutachten bei Fragen zur Testierfähigkeit
In den letzten Jahren ist es vielfach zu gerichtlichen Auseinandersetzungen in Zusammenhang mit der Beurteilung der Testierfähigkeit des (zumeist) bereits verstorbenen Testators sowie hierbei zur Beurteilung der psychischen bzw. kognitiven Ausgangslage, welche häufig in Zusammenhang mit einer dementiellen Erkrankung stehen, gekommen (siehe u.a. Lyketsos et al., 2002; Vonetta et al., 2010; Friedman et al., 2001).
Aus fachlicher Sicht ist bei der Beurteilung der Testierfähigkeit entscheidend, dass im Ergebnis neuropsychologischer Studien verschiedene Erkrankungen mit Beeinträchtigungen der Willensbildung bzw. Entscheidungsfindung einhergehen können, u. a. ist dies bei der Alzheimer Demenz (siehe u.a. de Siqueira et al. 2017), bei frontobasaler Demenz (siehe u.a. Gill et al. 2019), zudem bei Multipler Sklerose (Neuhaus et al. 2018) und dem Parkinson-Syndrom (Evens et al. 2016) zutreffend. Im Hinblick auf psychische Störungen zeigen sich mögliche Einschränkungen der Geschäfts- bzw. Testierfähigkeit v.a. bei depressiven Erkrankungen (siehe u.a. Pulcu et al., 2015) sowie bei dem Vorliegen von Psychosen ersichtlich (siehe u.a. Woodrow et al. 2019).
V.a. bei psychischen Störungen ist es dabei möglich, dass die der jeweiligen psychischen Störung zugrunde liegende Symptomatik im Verlauf wechseln kann, wie dies am Beispiel der depressiven Erkrankung und Ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen, (wie z.B. bei einem depressiven, manischen oder bipolar affektiven Syndrom bzw. Verlauf), zutreffend sein können (siehe u.a Alexander et al. 2017; Maercker et al., 2016).
Hierbei ist aus fachlicher Sicht entscheidend, dass bei der gutachterlichen Validierung der Testierfähigkeit die Diagnosestellung z.B. bzgl. einer dementiellen Erkrankung nicht ausreicht. Vielmehr ist es aus fachgutachterlicher Sicht erforderlich, dass der Schweregrad der dementiellen Erkrankung präzise beurteilt wird. In diesem Zusammenhang ist gutachterlich zu beurteilen, wie der Verlauf zwischen dem ersten Zeitpunkt seit der Diagnosestellung bis hin zum Datum der Testamentserrichtung hinsichtlich der krankheitsbedingten Symptomatik erfolgen. Entscheidend ist hierbei, dass die Krankheitsverläufe im Kontext einer dementiellen Erkrankung unterschiedlich sein können. Zwar ist es in den meisten Fällen zutreffend, dass mit einem demenziellen Syndrom auch die kognitiven Störungen stetig zunehmen. Dennoch zeigen sich verschiedene dementielle Erkrankungen in ihrer Progredienz auch deutlich variabel, weshalb v.a. retrospektive Berechnungen hinsichtlich der Erkrankungen und ihrer Auswirkungen auf die Testierfähigkeit komplex sind (siehe u.a. Walker et al. 2012; Wetterling 2014). Hierbei ist v.a. auch von fachlicher Bedeutung, dass es auch sehr schnell progrediente Fälle von Alzheimer Demenz gibt (siehe u.a. Schmidt et al. 2011).
V.a. Patienten zeigen mit einer Alzheimer-Demenz mit stark ausgeprägter Störung der Exekutivfunktionen einen schnelleren kognitiven Abbau im Vergleich zu Personen, bei denen leichtere Formen von Gedächtnisstörungen im Vordergrund stehen (siehe u.a. Mez et al. 2013). Entsprechend sind die in der Fachliteratur beschriebenen Durchschnittswerte hinsichtlich der Progredienz der Alzheimer Erkrankung sowie der hiermit einhergehenden neuropsychologischen Funktionseinschränkungen lediglich als ungefährer Richtwert anzusehen (siehe u.a. Wetterling et al. 1995).
Der BGH macht diesbzgl. in seiner Rechtsprechung in mehreren Urteilen zu erbrechtlichen Verfahren deutlich, dass die Beurteilung der Willensbildung und Urteilsfähigkeit in Verbindung mit der gutachterlichen Bewertung der Testierfähigkeit präzisiert und fachlich fundiert begründet werden sollen (siehe u.a. BGH- Urteil vom 05.12.1995, XI ZR 70/95).
Der hiermit in kausalen Zusammenhang stehende fachgutachterliche Nachweis beinhaltet die Beurteilung der Testierfähigkeit bzw. die hierhinter stehenden Prozesse der Urteilsfähigkeit bzw. Willensbildung (siehe u.a. Habermeyer & Saß, 2002b; Habermeyer, 2009; Reischies 2007).
Hierbei ist aus fachlicher Sicht entscheidend, sich bei der gutachterlichen Beurteilung der Testierfähigkeit mit den hierzu aktuellen neurowissenschaftlichen, neuropsychologischen und juristischen Untersuchungsergebnissen bzw. Entscheidungen auseinanderzusetzen bzw. diese in den Prozess der gutachterlichen Bewertungen präzise miteinzubeziehen. Hierbei ist zudem v.a. auch der Einbezug aus aktuellen forschungsrelevanten Fachbereichen relevant, um z.B. zu erläutern, wie z.B. die Alzheimer-Demenz die Prozesse der Willensbildung und Urteilsfähigkeit und damit die Testierfähigkeit beeinflussen kann (siehe u.a. Edwards et al., 2009; Van der Linde et al., 2014; Kales et al., 2015).
Aus einer bezogen auf den jeweiligen Einzelfall dargelegten Beschreibung der Prozesse der Willens- und Urteilsbildung können dann auch v.a. die defizitären neuropsychologischen Funktionen diesbzgl. am Einzelfall beleuchtet sowie im Hinblick auf ihre Auswirkungen bewertet werden. V.a. kann gutachterlich eingeschätzt werden, welche dementielle Erkrankung vorliegt, welcher Grad des dementiellen Erkrankungsstadiums erreicht erscheint sowie mit welchen konkreten Einschränkungen im Prozess der Willensbildung bzw. der Urteilsfähigkeit aufgrund dessen zu rechnen ist (siehe u.a. Darby und Dickerson 2017; siehe zudem Fellows 2018, Lee und Seo 2016).
Dieser Fachartikel befasst sich dementsprechend mit aktuellen, u.a. neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und auf dieser Basis erfolgt eine sachverständige Auseinandersetzung mit sich hieraus ergebenden Folgewirkungen für die gutachterliche Validierung und juristische Beurteilung der Testierfähigkeit nach § 2229, Absatz 4 BGB.
Es wird hierbei u.a. erörternd aufgezeigt, wie sich die unterschiedlichen dementiellen Erkrankungsstadien v.a. der Alzheimer Demenz auf die bei der Testierfähigkeit nach § 2229, Absatz 4 BGB, zu beurteilenden Prozesse der Willensbildung und Urteilsfähigkeit auswirken können (siehe u.a. Habermeyer & Saß, 2002b; Finkel et al., 1996; Kales et al., 2015; Tyrer et al., 2006). Hierbei wird u.a. präzise auf die unterschiedlichen Demenzphasen und ihrer jeweiligen Auswirkungen auf die Testierfähigkeit eingegangen (siehe u.a. de Vugt et al., 2006; Iliffe et al., 2015; Brodaty et al., 2015).
Es erfolgt hierbei insbesondere eine vertiefte Auseinandersetzung der neurowissenschaftlichen bzw. neuropsychologischen Perspektiven hierzu sowie ihres Nutzens für gutachterliche Differenzierungen zu gerichtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit dementiellen Erkrankungen sowie der Beurteilung der Testierfähigkeit nach § 2229 Absatz 4 BGB bei erbrechtlichen Verfahren (siehe u.a. Hughes et al., 2006; Dubois et al., 2016; Aalton et al., 2006).
Diese soll insbesondere die aus neurowissenschaftlicher Sicht in Zusammenhang mit dem juristischen Terminus der freien Willensbildung geltenden Definitionen umfassen und hierbei aufzeigen, welche Prozesse explizit die Willensbildung und Urteilsfähigkeit beinhalten und wie diese sich durch psychische bzw. neurologische Erkrankungen, v.a. am Beispiel der Alzheimer- Demenz, beeinflusst abbilden und auch Einschränkungen der Testierfähigkeit begründen können (siehe u.a. Bartsch, 2013b; Fleischer, 2015; Jahn, 2015; Kales et al., 2015).
Hierbei wird auch aufgezeigt, weshalb nicht explizit bei dem Vorliegen einer Alzheimer-Demenz von einer Testierunfähigkeit ausgegangen werden kann. In diesem Zusammenhang wird v.a. auf die wichtige stadienbezogene Klassifizierung der Alzheimer- Demenz sowie ihrer Auswirkungen auf die Testierfähigkeit eingegangen (siehe u.a. Calabrese et al., 2013).
Zudem wird abschließend ein zusammenfassender Überblick darüber gegeben, welche empirischen Erkenntnisse bisher aus der neurowissenschaftlichen bzw. auch neuropsychologischen Forschung über demenzassoziierte Veränderungen in Relation zu hiermit verbundenen Einschränkungen der Willensbildung und Urteilsfähigkeit im Kontext der Beurteilung der Testierfähigkeit erbracht werden konnten (siehe u.a. Lancet 2001).
Diese Untersuchungsergebnisse und Erkenntnisse werden zudem im Hinblick auf die Begutachtung der Testierfähigkeit hin diskutiert, v.a. wird hierauf bezogen aufgezeigt, welche Mindestanforderungen an Fachgutachten in erbrechtlichen Verfahren vorliegen sollten, wie bzw. mit welchen Hilfsmitteln die Testierfähigkeit valide beurteilt werden kann. Es wird auf zukunftsbezogene mögliche Änderungen verwiesen, die z.B. auch auf eine bei Verdacht auf Demenz bestehende vorherige, notwendige Beurteilung der Testierfähigkeit verweisen sollen (siehe u.a. Lee et al. 2018, Zammit et al. 2019).
Der vorliegende Fachartikel setzt sich daher v.a. mit der Testierfähigkeit unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts der Willensfreiheit sowie der Fähigkeit zur Willens- und Urteilsbildung in erbrechtlichen Verfahren auseinander.
Rechtspraktischer Anknüpfungspunkt sind hierbei erbrechtliche Auseinandersetzungen, die auftreten, wenn der Erblasser im hohen Alter zum Nachteil naher Angehöriger einen Dritten letztwillig begünstigt und die Testierfähigkeit des Erblassers wegen dementieller Erkrankung angezweifelt werden.
In diesem Artikel wird zudem v.a. aufgezeigt, wie präzise gutachterliche Untersuchungen zur Validierung der Testierfähigkeit sein müssen und welche Untersuchungs- und Bewertungsprozesse vor dem Hintergrund aktenkundiger Bezüge erforderlich werden. Eine fachlich präzise Beurteilung der Testierfähigkeit bei dementiellen Erkrankungen machen fundierte und wissenschaftlich nachvollziehbare Untersuchungs- und Bewertungsvorgehensweisen notwendig.
Dabei ist wesentlich, dass sowohl die zuverlässige und gültige Beurteilung einzelner Krankheitsbilder und ihrer Auswirkungen als auch die Beantwortung kausaler Fragestellungen zu ihrer Verursachung oder Entstehung, erkenntnis- und handlungsleitende theoretische Konzepte und Modelle notwendig machen (auch bei retrospektiven Begutachtungen nach dem Tot eines Erblassers).
Dabei ist die Begutachtung und Bewertung der Testier(un)fähigkeit wie auch die Validierung hiermit assoziierter psychischer bzw. kognitiver Erkrankun- gen und Erkrankungsfolgen einzubetten in theore- tische Modelle der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage, zudem ist auch die dezidierte Validierung der (vorgeschichtlichen) Behandlungskonzepte und –Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung.
In Zusammenhang mit der Bewertung der Testierfähigkeit sind hierbei auch der Verlauf und die Auswirkungen der vorgeschichtlichen Ereignisse (z.B. Verschlechterung des körperlichen Krankheitszustandes, Vorliegen psychischer Erkrankungen, Komorbidität, Medikation und mögl. Folge-/Wechselwirkungen etc.) auf die emotionale und kognitive Verfassung u.a. genauso wesentlich wie die Validierung der Auswirkungen der eingenommenen Medikamente (siehe u.a. Lyketsos et al., 2002; siehe zudem Steinberg et al. 2008; Wadsworth et al. 2012; Wetzels et al. 2010).
Zudem sind kritische Auseinandersetzungen mit Klinikberichten u.a. notwendig, da z.B. bei nicht erfolgter Berichterstattung zur z.B. dementiellen Erkrankung nicht davon ausgegangen werden kann, dass solche zum Behandlungs- bzw. Untersuchungszeitraum (anderer Erkrankungen) nicht bestanden haben. Insbesondere eignen sich Rückschlüsse hierzu nicht, wenn innerhalb anderer, nicht auf z.B. dementielle Erkrankung bezogene Untersuchungen, stattgefunden haben.
In diesem Zusammenhang sind auch die juristischen Grundlagen zur Beurteilung der Testierfähigkeit grundlegend im Kontext einer gutachterlichen Bewertung dergleichen zu berücksichtigen: Hierbei ist wesentlich, dass im Sinne der juristischen Termini Testierunfähigkeit vorliegt, „wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist“ (§ 104 Nr. 2 BGB).
Der Begriff der sog. „krankhaften Geistestätigkeit“ umfasst nicht nur endogene und exogene Psychosen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen und stoffgebundene Suchterkrankungen, sondern beinhaltet auch „Geistesschwäche bzw. Oligophrenie“, wobei die Störung ihrer Art und Schwere nach so ausgeprägt sein muss, dass hierdurch bedingt die freie Willensbestimmung bzw. die Urteilsfähigkeit ausgeschlossen werden.
Dies ist dann anzunehmen, wenn die betroffene Person nicht fähig ist, ihre Entscheidungen von vernünftigen Erwägungen abhängig zu machen. Die juristischen Voraussetzungen nach § 2229 BGB sind demzufolge als nicht erfüllt anzusehen, wenn ein Erblasser nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.
Für die Beurteilung der Testierfähigkeit sind entsprechende fachliche Kriterien von wesentlicher Bedeutung: Hierbei entscheidend ist jeweils der Zustand während der Abgabe der Willenserklärung (u.a. bezogen auf den Zeitpunkt von Unterschrift, Änderung oder Widerruf).
Die Beurteilung der Testier(un)fähigkeit hat demzufolge auf zwei Ebenen zu erfolgen: Zunächst ist zu prüfen, ob zum fraglichen Zeitpunkt eine krank- heitswertige neurologische und/oder psychische Störung im juristischen Sinne vorlag (Im Sinne der Beurteilung der diagnostischen Ebene). Ist diese fachliche Eingangsvoraussetzung gegeben, so muss auf der zweiten Beurteilungsebene geprüft werden, ob diese Störung psychische bzw. neuropsychologische Funktionsdefizite zur Folge hatte, die den Erblasser im fraglichen Zeitraum an einer freien Willensbestimmung bzw. Urteilsfähigkeit gehindert haben (Im Sinne der Beurteilung der Symptomebene).
Es kommt demzufolge auf fachgutachterlicher Sicht nicht darauf an, ob der Erblasser überhaupt zur („natürlichen“) Willensäußerungen fähig war, sondern allein auf die Freiheit seiner Willensbestimmung – „damit ist die Freiheit von krankheitsbedingten Beeinträchtigungen“ gemeint.
Entsprechend ist wesentlich zu fokussieren, dass die Beurteilung der Testierfähigkeit oft v.a. eine retrospektive Validierung der Verlaufsergebnisse in Relation zum Erkrankungszustand hinsichtlich des Termins zur Testamentserrichtung darstellt. In juristischer Hinsicht werden deswegen v.a. Wahrscheinlichkeitsannahmen erforderlich, wonach im Sinne eines „positiven Nachweis“ das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen einer entsprechenden Erkrankung als Voraussetzung für die Beurteilung der u.a. Testier(un)fähigkeit wesentlich sind (vgl. OLG München, Beschluss v. 31.10.2014 – 34 Wx 293/14; OLG Saarbrücken, Beschluss v. 03.03.2004 – 4 UH 754/03).