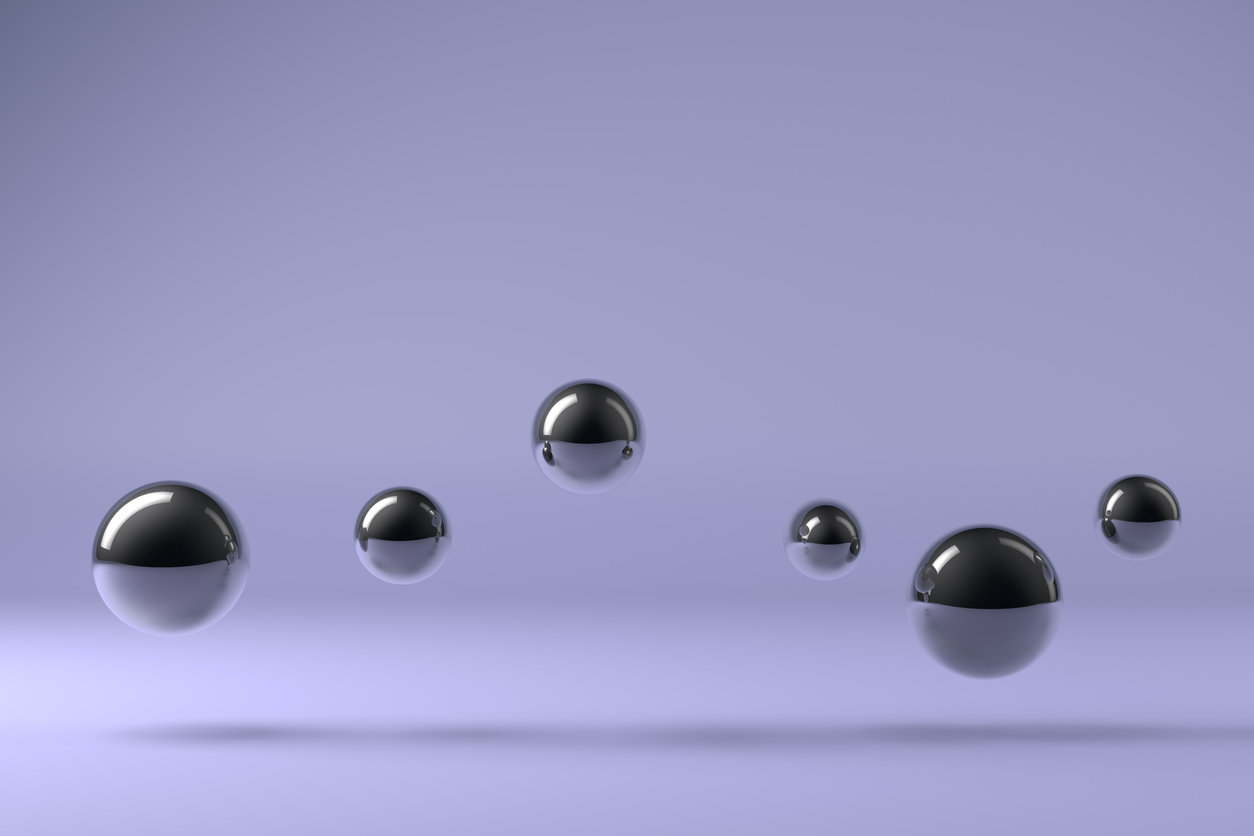Testierunfähigkeit
Nach § 2229 Abs. 4 BGB ist ein Erblasser testierfähig, wenn er die Bedeutung seiner Verfügung und ihre Auswirkungen auf seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse versteht und in der Lage ist, Gründe für und gegen seine Anordnungen eigenständig abzuwägen und frei von übermäßigen Einflüssen Dritter zu entscheiden. Entscheidend ist dabei nicht allein das Vorliegen einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche, sondern in einem zweistufigen Verfahren zunächst auf der diagnostischen Ebene die Art der Störung festzustellen und sodann auf der psychopathologischen Ebene zu prüfen, ob diese Störung die Einsichts- und Willensfähigkeit so weit beeinträchtigt hat, dass keine freie Willensbildung mehr möglich war. Ein Erblasser gilt als testierfähig, bis zum Beweis des Gegenteils.
Im Verfahren 19 W 76/23 hatte das Kammergericht Berlin über eine Beschwerde gegen einen Erbscheinsbeschluss zu entscheiden, mit dem das Amtsgericht Charlottenburg die Testierfähigkeit eines 85-jährigen Betreuten verneint und ihn als Erben zu je ½ für zwei handschriftliche Testamente von 2017 und 2018 eingesetzt hatte. Der Beteiligte zu 2) rügte, die von seinem Vater zum Handeln ermächtigte Betreuerin habe einen Einfluss auf den Inhalt des Testaments ausgeübt; zudem fehle ein ärztliches Gutachten, das den Testierunfähigkeitsvorwurf stütze. Das KG wies die Beschwerde jedoch zurück: Das Amtsgericht hatte in sorgfältiger Amtsermittlung zunächst alle bisherigen ärztlichen Befunde, die demenziellen Testergebnisse (u. a. Mini-Mental-Status- und Uhrentests) und die umfangreiche Zeugenaussage von Behandlern ausgewertet; anschließend holte es ein fachärztliches Sachverständigengutachten ein, das – vide seinen lückenlosen Dokumentationsbefund – mit hoher Beweissicherheit eine mittelschwere Alzheimer-Demenz nachwies, die schon im Oktober 2018 jede Einsicht in die Tragweite testamentarischer Verfügungen ausschloss. Zentrale Interventionen Dritter oder motivierendes Vertrauen in Vorschläge nahestehender Personen genügten nicht, wenn die kognitiven Voraussetzungen für selbständige Urteilsbildung fehlen.
Mit diesem Beschluss hat das KG klargestellt, dass Testierfähigkeit weder graduell gestuft noch an die Abwägung einfacher oder schwieriger Verfügungen geknüpft ist: Sie fehlt ganz oder ist nach § 2229 Abs. 4 BGB vorhanden. Bei fortschreitenden Demenzen vom Alzheimertyp nahe liegt regelmäßig die Annahme fehlender Einsichtsfähigkeit, so dass – wie hier – ein „lichtes Intervall“ praktisch ausgeschlossen ist. Zudem bekräftigt der Senat, dass unspezifische Verdachtsmomente oder pauschale Einfluss-Behauptungen ohne hinreichend konkreten Beweis behindern, das zwingende Erfordernis der vollständigen gerichtlichen Aufklärung nicht. Nur wenn auch nach Ausschöpfung aller Ermittlungsmaßnahmen – ärztliche Befunde, Testergebnisse, Zeugenaussagen – überzeugend nachgewiesen ist, dass der Erblasser in gedanklicher Unabhängigkeit keinen Erbwillen mehr fassen konnte, ist ein Testament unwirksam. In allen anderen Fällen gilt der Grundsatz „Testierfähigkeit bis zum Beweis des Gegenteils“ fort.
KG, Beschl. v. 25.7.2024 – 19 W 76/23 (AG Charlottenburg Beschl. v. 10.3.2023 – 61 VI 1238/20)