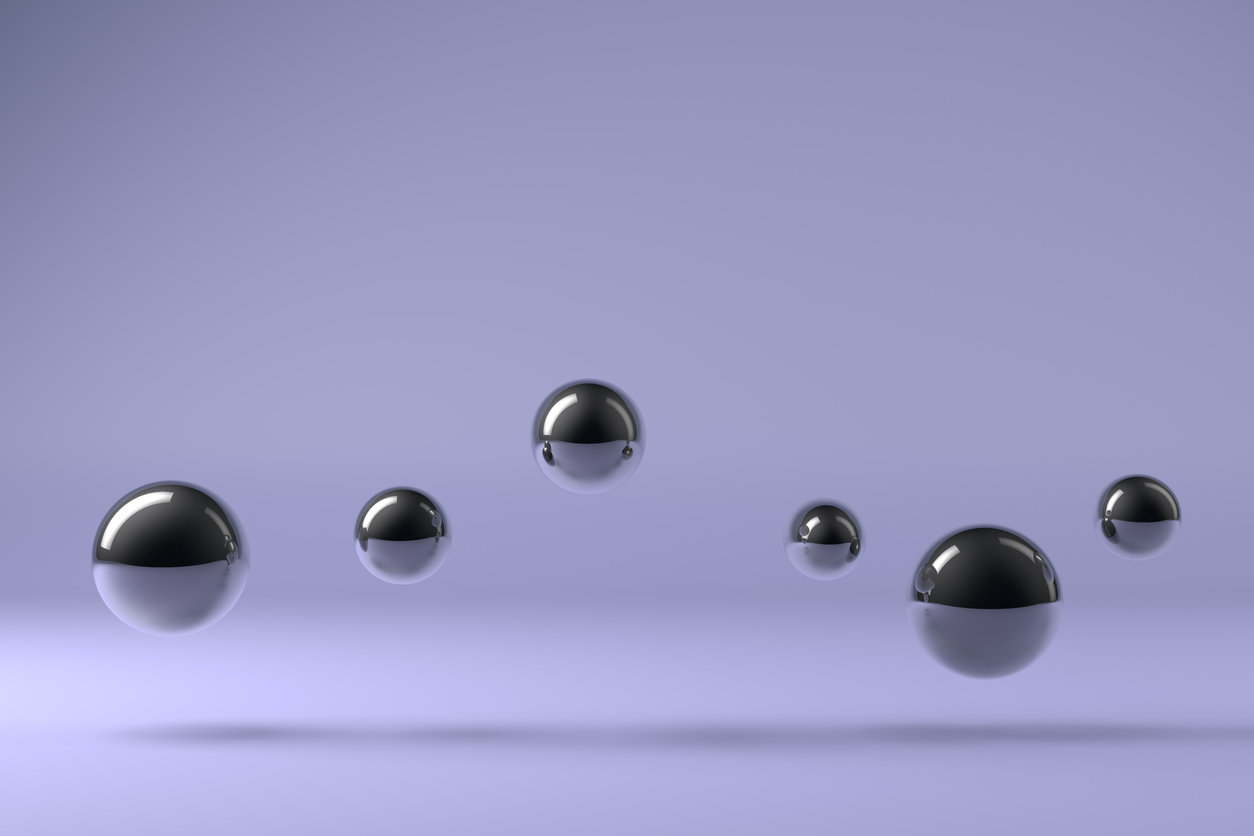OLG Hamm (10. Zivilsenat), Beschluss vom 29.05.2024 – 10 W 8/23
Testierunfähigkeit
bei Alzheimer-Demenz
BGB § 2229 Abs. 4, § 2267, § 2268 Abs. 1, § 2077
Das Oberlandesgericht Hamm hat mit seinem Beschluss vom 29. Mai 2024 (10 W 8/23) ein hohes Maß an Substantiierung verlangt, bevor einem vermeintlich demenziell erkrankten Erblasser die Fähigkeit zur Testamentserrichtung abgesprochen werden kann. Nach den §§ 2229 Abs. 4, 2267, 2268 Abs. 1, 2077 BGB setzt Testierunfähigkeit voraus, dass der Erblasser wegen krankhafter Störung seiner Geistestätigkeit nicht mehr die Bedeutung eines letzten Willens erfassen und danach handeln kann. Zwar liegt bei mittelschwerer, degenerativ fortschreitender Alzheimer-Demenz regelmäßig eine Einschränkung der Einsichtsfähigkeit vor, doch darf der Schluss auf Testierunfähigkeit nicht schon aus der Diagnose allein gezogen werden: Ein „lichtes Intervall“ ist zwar bei Alzheimer-Demenz nahezu ausgeschlossen, gleichwohl muss die konkrete kognitive Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung geprüft werden.
Im vorliegenden Fall hatte der Erblasser in den Jahren 2011 und 2012 zwei Einzeltestamente errichtet, mit denen er seine Töchter A. und U. abweichend von einem früheren gemeinschaftlichen Ehegattentestament als Alleinerbinnen setzte. Weil der Erblasser seit 2006 an Alzheimer-Demenz litt, holte das Amtsgericht Gutachten seiner behandelnden Ärzte M. und H. ein sowie ein eigenständiges Sachverständigengutachten (Dr. XC.). Zusätzlich befragte es zwei beurkundende Notare, seine langjährige Sekretärin, den Lebensgefährten und weitere Zeugen. Die Zeugen schilderten übereinstimmend deutliche kognitive Ausfälle, Raumorientierungsprobleme und fortschreitende Vergesslichkeit, die auch in ärztlichen Mini-Mental-Status-Tests und Uhrentests dokumentiert worden waren. Dr. XC. stellte insbesondere heraus, dass die Testergebnisse im Jahr 2011 bereits eine hochgradig gestörte gedächtnisorientierte und visuo-konstruktive Leistungsfähigkeit belegten, sodass von einer freien Willensbildung und einer ernsthaften Abwägung des Für und Wider testamentarischer Verfügungen keine Rede mehr sein könne. Einen lichten Moment schloss er ebenso wie sämtliche behandelnden Ärzte aus.
Das OLG hob hervor, dass nicht allein die Diagnose Alzheimer-Demenz, sondern deren konkrete Ausprägung im Testzeitraum ausschlaggebend ist. Die von den Notaren im Beurkundungstermin wahrgenommenen „klaren“ Augenblicke genügten nicht: Bei Demenz gelte der Maßstab, dass ein einmal eingetretener Abbau irreversibel sei und kognitive Defizite nicht vorübergehend überwunden würden. Auch eine Beurteilung aus familiärer Perspektive (Fernsehbeitrag, Autobiografie der Tochter) vermochte die reichhaltige, konsistente Beweisaufnahme nicht zu erschüttern. Gleichwohl betonte das OLG, dass sich jedes Urteil an einer umfassenden Gesamtwürdigung sämtlicher Erkenntnisse zu orientieren habe – ärztliche Gutachten, Zeugenaussagen und Testergebnisse gleichermaßen.
Weil der Erblasser bereits 2011 testierunfähig gewesen sei, seien die beiden späteren Einzeltestamente unwirksam. Damit trat die gesetzliche Erbfolge ein: Die Töchter A. und U. erben zu je einem Halbteil. Weitere Rechtsmittel ließ das OLG nicht zu, da es sich um eine einzelfallbezogene Würdigung handelte. Mit seinem präzisen Vorgehen hat der 10. Senat klargestellt, dass bei Alzheimer-Demenz nicht jede letztwillige Verfügung automatisch unwirksam ist, wohl aber einer streng überprüften Beweiswürdigung bedarf, wenn geltend gemacht wird, der Erblasser habe im Zeitpunkt der Testamentserrichtung nicht mehr urteilsfähig disponieren können.
OLG Hamm Beschl. v. 29.5.2024 – 10 W 8/23