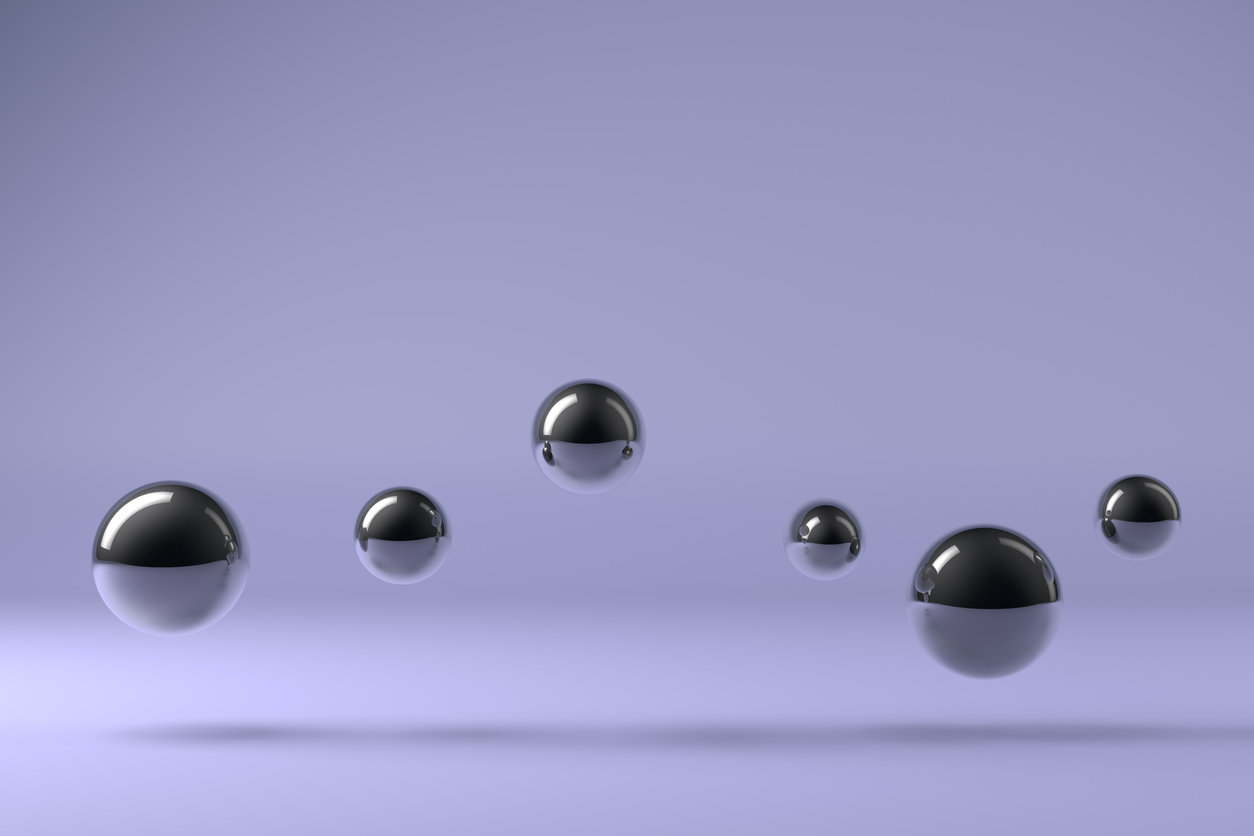OLG Düsseldorf Beschluss vom 4.11.2013 – I-3 Wx 98/13:
Umfang der Aufklärungspflichten des Nachlassgerichts
BGB § 2229 IV; FamFG § 26
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in seinem Beschluss vom 4. November 2013 (I-3 Wx 98/13) noch einmal klargestellt, dass das Nachlassgericht keine eigenen Ermittlungen zur Testierunfähigkeit eines Erblassers anstellen muss, solange sich aus den Akten keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Erblasser an einer geistigen Erkrankung (etwa einer Demenz) litt oder je deshalb behandelt wurde.
Sachverhalt
Eine kinderlose Erblasserin setzte in einem im Mai 2011 gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann beurkundeten Ehegattentestament eine von drei Beteiligten (eine kurz zuvor gegründete Stiftung) zur Alleinerbin ein. Ihre beiden Schwestern beantragten daraufhin, den Erbscheinsantrag der Stiftung abzulehnen und sie selbst als gesetzliche Erbinnen zu jedem ½-Anteil auszuweisen. Sie rügten in der Hauptsache die Testierunfähigkeit der Erblasserin wegen einer angeblichen Demenz. In einem beschleunigten Verfahren (Eilantrag) ordnete das Nachlassgericht Wesel deshalb die Beibringung konkreter Anhaltspunkte an: Es forderte die Schwestern auf, ärztliche Befunde oder den Namen behandelnder Ärzte vorzulegen, die eine geistige Erkrankung der Erblasserin nahelegen. Nachdem die Schwestern keine derartigen Unterlagen eingereicht hatten, stellte das Nachlassgericht insoweit die erforderlichen Tatsachen für den Erbscheinsantrag der Stiftung fest und wies die Beschwerde zurück.
Rechtliche Erwägungen
- Erbscheinsverfahren und Feststellungslast
Nach § 2353 BGB bezeugt der Erbschein das Erbrecht zum Zeitpunkt des Erbfalls; er wird nur erteilt, wenn das Nachlassgericht (§ 2359 BGB) alle tatsachenfeststellungs-pflichtigen Umstände, die für den Erbscheinantrag erforderlich sind, festgestellt hat. Sind jedoch Anhaltspunkte dafür, dass der Erblasser bei Errichtung seines Testaments testierunfähig war, zu ermitteln, verlangt § 26 FamFG die Amtsaufklärung, ggf. durch Sachverständigengutachten. - Umfang der Aufklärung
Die Pflicht zu amtswegiger Aufklärung endet dort, wo kein Anhalt dafür besteht, dass der Erblasser an einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, Demenz etwa, gelitten hat oder je deswegen ärztlich behandelt wurde. Die bloße Behauptung einer Demenz genügt nicht, ohne konkrete, nachprüfbare Symptome—beispielsweise unregelmäßige Orientierungsfähigkeiten, Halluzinationen oder Verwirrtheit—die auf die für Testierunfähigkeit maßgeblichen Einsichts- und Willensstörungen hindeuten. Praktische Anwendung im Streitfall
– Die Schwestern hatten weder ärztliche Atteste noch Namenslisten von behandelnden Ärzten vorgelegt.
– Aus ihrer Beschwerde entsprach keinerlei konkreter Hinweis darauf, dass die Erblasserin etwa in der Zeit vor Mai 2011 verwirrt umherirrte, fremde Stimmen hörte oder deutliche Bewusstseinsstörungen zeigte.
– Der Notar hatte das Ehegattentestament ohne Vorbehalte beurkundet und die Erblasserin für testierfähig gehalten.In dieser Gesamtschau erkannte das Nachlassgericht—und bestätigte das Oberlandesgericht—ohne Verstoß gegen § 26 FamFG die Erteilung des Erbscheins für die Stiftung.
Auswirkungen und Bedeutung
- Ist kein konkreter Verdacht auf Demenz oder vergleichbare Geisteskrankheit begründet, muss das Nachlassgericht nicht weiter in eigener Initiative ermitteln und kann den von einem Erben gestellten Erbscheinsantrag sachgerecht entscheiden.
- Testierunfähigkeit lässt sich im Eilverfahren—anders als im Hauptsacheverfahren—nicht allein aus Allgemeinbehauptungen oder vagen Erinnerungen an Pflegebedürftigkeit oder Aneurysmen herleiten. Es muss mindestens ein nachvollziehbarer, symptomatischer Befund vorliegen, der für den Ausfall der erforderlichen geistigen Funktionen spricht.
- Der Beschluss präzisiert damit den Rahmen der Amtsaufklärung im Erbscheinsverfahren und verhindert irrelevante Gutachten oder verzögernde Nachforschungen, wenn keine belastbaren Anhaltspunkte für Testierunfähigkeit vorliegen.