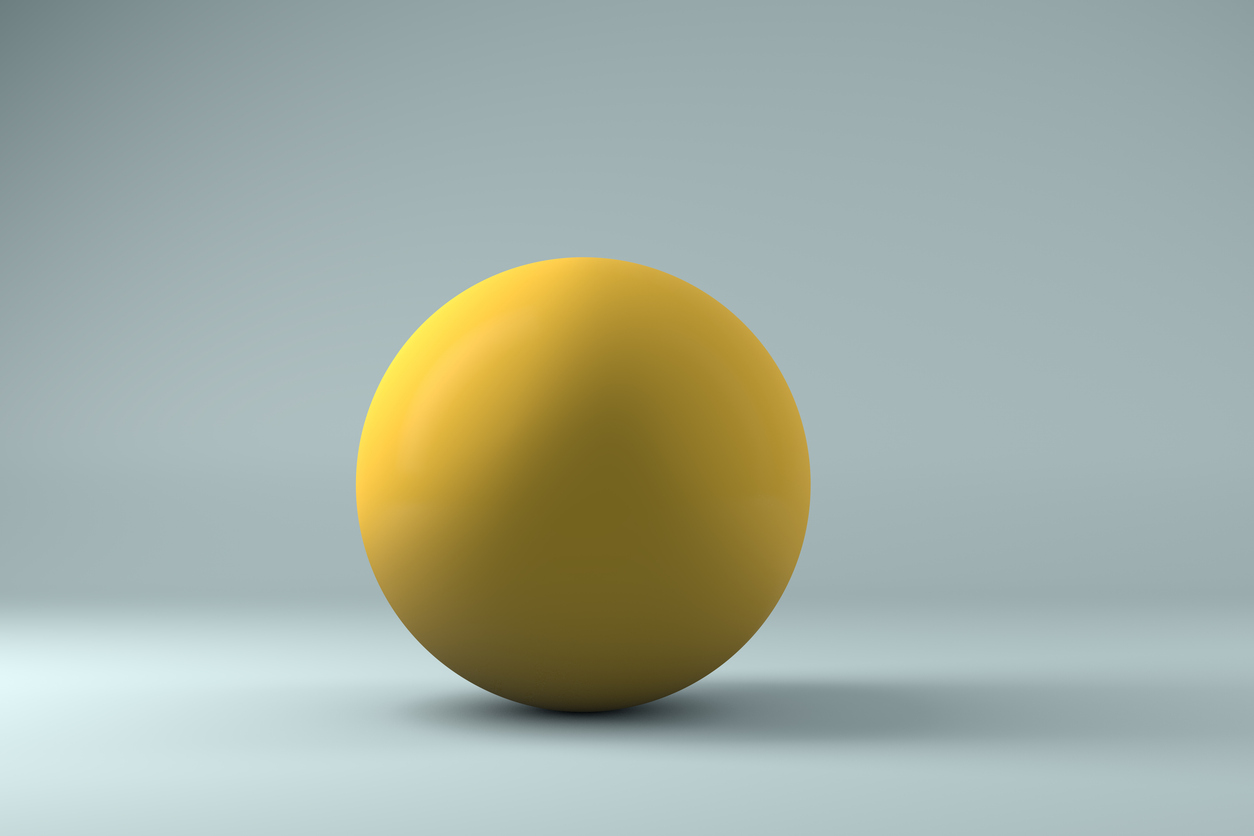Verfassungsrechtliche Anforderungen an vollständigen Sorgerechtsentzug
Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 17.11.2023 – 1 BvR 1037/23
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 17. November 2023 (Az. 1 BvR 1037/23) klargestellt, dass Art. 6 Abs. 3 Grundgesetz selbst dann höchste verfassungsrechtliche Anforderungen ansetzt, wenn Eltern einem Fremdunterbringungsbeschluss bereits zugestimmt haben oder wenn ein bestellter Vormund das Kind zwar nicht aus der bisherigen Unterbringung herausnehmen, aber dennoch die elterliche Sorge vollständig ersetzen möchte. Denn der Entzug der elterlichen Sorge stellt eine tiefgreifende, in das Grundrecht der Eltern und das Leib und Leben des Kindes eingreifende Gewaltmaßnahme dar, die den strengen Maßstab einer richterlichen Entscheidung mit umfassender Sachaufklärung und Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt.
Erstmals ist in diesem Beschluss ausdrücklich hervorgehoben worden, dass das Familiengericht schon bei der Anordnung eines vollständigen Sorgerechtsentzugs – auch wenn das Kind weiterhin bei einem Elternteil verbleibt oder eine Fremdunterbringung fortbesteht – konkret darlegen muss, worin die Überlegenheit der Sorgeführung durch den Vormund gegenüber den Eltern besteht. Es genügt nicht, allgemein auf eine Kindeswohlgefährdung hinzuweisen; vielmehr muss präzise beschrieben werden, welche spezifischen Maßnahmen der Vormund ergreifen würde, um die dem Kind drohenden Schädigungen abzuwenden, die die Eltern unterlassen haben.
Darüber hinaus hat das Gericht bekräftigt, dass – insbesondere bei psychischen Auffälligkeiten oder wenn eine zwangsweise therapeutische Behandlung des Kindes in Betracht kommt – nicht ausschließlich ein psychologisches Gutachten erforderlich ist, sondern auch ein fachärztliches kinder- und jugendpsychiatrisches oder psychotherapeutisches Gutachten eingeholt werden sollte. Nur so lässt sich hinreichend sicher feststellen, ob und in welchem Umfang die erforderliche Therapie das Kindeswohl tatsächlich fördert und die Freiwilligkeit medizinischer Maßnahmen nicht verletzt.
Bei der abschließenden Verhältnismäßigkeitsprüfung hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass eine sorgerechtliche Entscheidung stets eine Gesamtwürdigung sein muss: Es ist zu prüfen, ob die Trennung des Kindes von seinen Eltern und die damit verbundenen Folgen – etwa Verlust von Bindungen, Identitätsprobleme und psychische Belastungen – durch die vorgesehene Fremdunterbringung oder Vormundschaft insgesamt ausreichend aufgewogen werden von der Erwartung, dass das Kind in seiner Entwicklung nachhaltig eine gesündere und sicherere Umgebung findet.
Schließlich hob das Gericht hervor, dass ein psychologisches Sachverständigengutachten nur dann eine verlässliche Grundlage bildet, wenn es ausdrücklich auf den familiengerichtlichen Rechtsmaßstab der Kindeswohlgefährdung abstellt und nicht etwa auf ein allgemein-psychologisches Kompetenzprofil. Fehlt diese rechtliche Einbettung, sind die Ergebnisse psychologischer Tests keineswegs ohne Weiteres verwertbar.
Insgesamt verdeutlicht der Beschluss, dass ein vollständiger Entzug der elterlichen Sorge nicht mit dem üblichen Maß familienrechtlicher Fürsorge oder Vormundschaft gleichzusetzen ist, sondern einer gesonderten, besonders sorgfältigen rechtsstaatlichen Prüfung bedarf – selbst in Konstellationen, in denen Eltern bereits einer Fremdunterbringung zugestimmt haben oder der Vormund keine unmittelbare Entmündigung der Eltern beabsichtigt. Die Entscheidung stellt damit einen wichtigen Verankerungspunkt für das Verfassungsrecht des Kindes- und Jugendhilferechts dar.