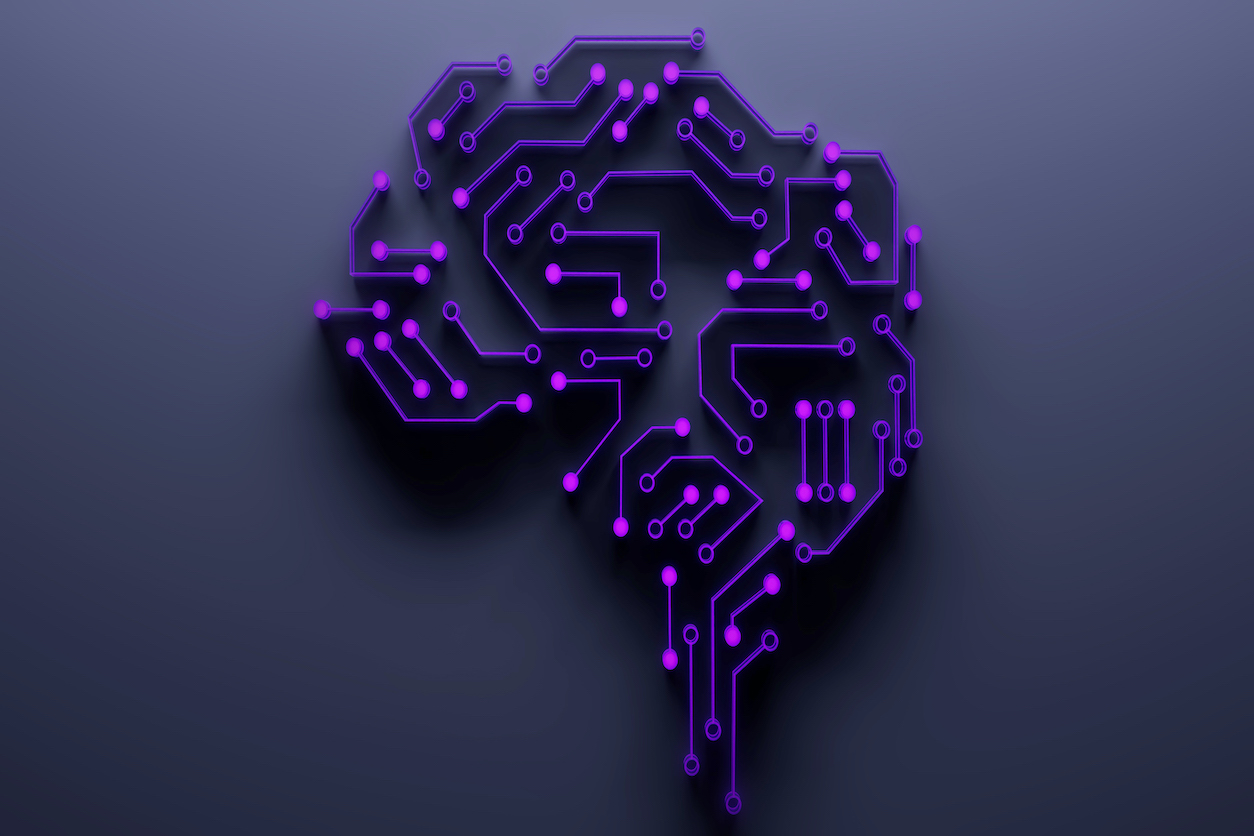Was im Gehirn von traumatisierten Menschen geschieht
Traumatische Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn – nicht nur auf der psychischen Ebene, sondern auch in Form nachweisbarer Veränderungen in neuronalen Netzwerken, die Wahrnehmung, Reaktion und Verhalten beeinflussen. Ein klassisches Beispiel ist der Soldat, der im Einsatz durch Schüsse oder Explosionen massiv überfordert und erschüttert wird. Wieder zuhause reicht dann oft schon das Zuknallen einer Tür, um eine überwältigende Stressreaktion mit Herzrasen, Zittern oder Übelkeit auszulösen.
Derartige Reaktionen sind kennzeichnend für eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS).
Wenn das Gehirn unter Extrembedingungen lernt
Die PTBS entsteht als verzögerte Reaktion auf extrem belastende Ereignisse, die eine außergewöhnliche Bedrohung darstellen – sei es ein einzelnes Schockerlebnis oder eine chronisch belastende Situation. Anders als viele psychische Störungen betrifft die PTBS eine Vielzahl mentaler und körperlicher Funktionen gleichzeitig. Zu den typischen Symptomen gehören:
- Flashbacks, also das ungewollte Wiedererleben des Traumas,
- Schlafstörungen, vor allem mit gestörtem REM-Schlaf und Albträumen,
- Übererregung, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit,
- dissoziative Zustände, wie Depersonalisation oder das Gefühl, „neben sich“ zu stehen,
- emotionale Taubheit, Rückzug und Vermeidungsverhalten,
- sowie Veränderungen in sozialem Verhalten und Selbstbild.
Die Erkrankung kann sich Wochen oder Monate nach dem Trauma entwickeln und zeigt einen vielgestaltigen, individuell stark variierenden Verlauf – von akuter Reaktion bis hin zu chronischer Persönlichkeitsveränderung.
Was passiert dabei im Gehirn?
Die moderne Bildgebung hilft dabei, die neurologischen Grundlagen der PTBS besser zu verstehen. Lange galt ein amygdalozentrisches Modell als führend: Es stellte die Amygdala – das Zentrum für Angstverarbeitung – ins Zentrum der Erklärung, vor allem im Hinblick auf die übersteigerte Furchtreaktion.
Doch neuere Studien zeigen: Dieses Modell greift zu kurz. Viele zentrale Symptome der PTBS – etwa Dissoziation, emotionale Abstumpfung oder soziale Rückzugsverhalten – lassen sich allein über die Amygdala nicht hinreichend erklären.
Neue Perspektiven auf traumabezogene Gehirnveränderungen
Aktuelle Forschung bezieht komplexere Netzwerke in die Betrachtung ein – darunter Strukturen, die an Furchtkonditionierung, Habituation und Extinktion beteiligt sind. Entscheidend ist nicht nur, was das Gehirn in traumatischen Situationen aktiviert, sondern auch, was es in Ruhe tut – also wie Gedächtnisinhalte, Affekte und Körperwahrnehmungen verknüpft und neu bewertet werden.
Traumatische Erfahrungen verändern nicht nur die akute Reaktion auf Bedrohung, sondern auch die Art, wie das Gehirn künftige Erfahrungen interpretiert und reguliert.