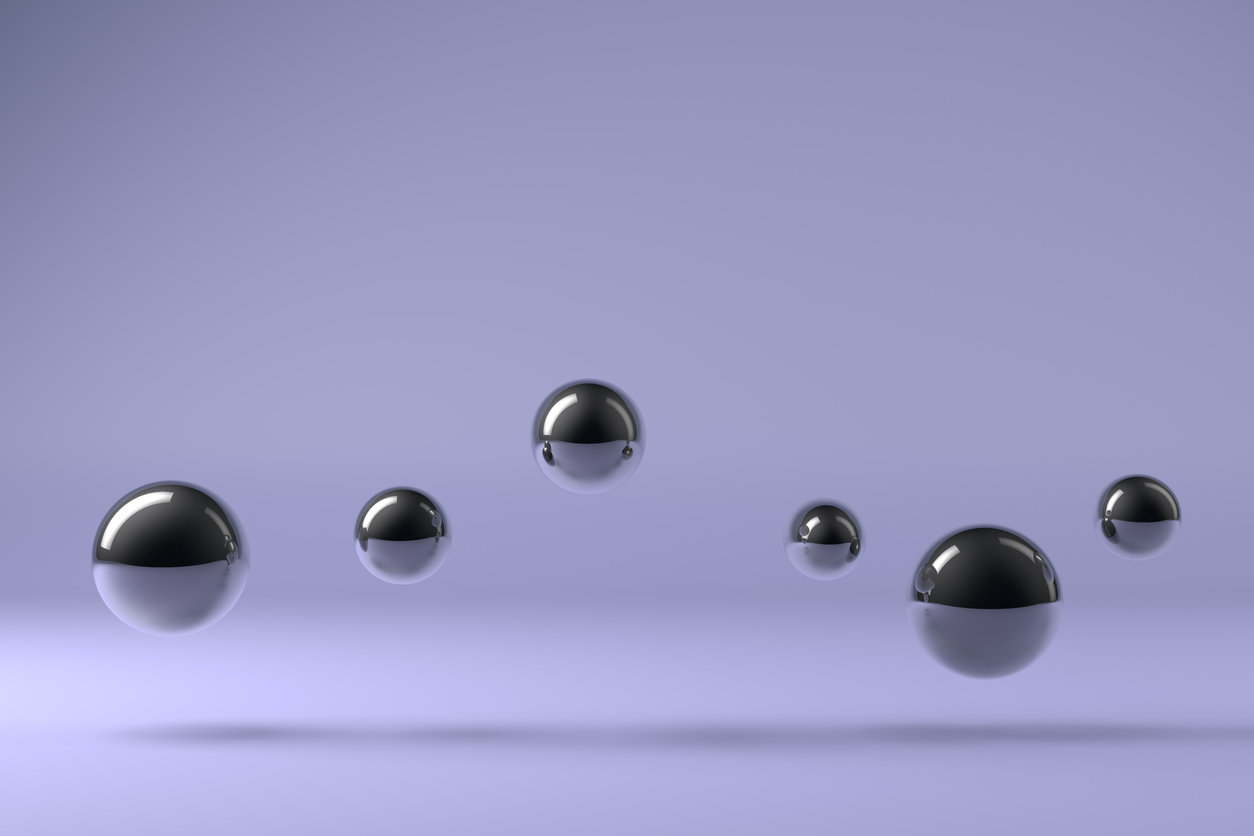OLG Hamm, Urt. v. 13. 7. 2021 – 10 U 5/20 Zur Beweiswürdigung bezüglich der Geschäftsfähigkeit wegen Demenz
In dem OLG Hamm, Urteil vom 13. Juli 2021 – 10 U 5/20 ging es um die Wirksamkeit eines notariellen Aufhebungsvertrags (Erb- und Pflichtteilsverzichtsaufhebung) zwischen einem damals 86-jährigen Erblasser und seinem Sohn. Der Sohn verlangte seinen Pflichtteil, obwohl er 1996 per Vertrag auf seinen Erb- und Pflichtteilsanspruch verzichtet hatte. Im August 2009 hatten Vater und Sohn vor einem Notar wieder vereinbart, den Verzicht aufzuheben. Später stellte der Sohn jedoch im Prozess gegen den Erben (seinen Halbbruder) die Geschäftsfähigkeit seines Vaters infrage und berief sich darauf, dieser leide bereits an Alzheimer-Demenz und sei zum Zeitpunkt der Aufhebung geschäftsunfähig gewesen.
Sachlage und Behandlungsbefunde
- 2003/2004: Erste Hinweise auf mnestische Defizite, Verdacht auf Demenz.
- Juli 2009: Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie dokumentiert eine leichte bis mittelgradige Demenz und empfiehlt Betreuung für Vermögensangelegenheiten.
- August 2009: Notar E beurkundet die Aufhebung des Pflichtteilsverzichts. Die Urkunde enthält keinen Vermerk über eine Überprüfung der Geschäftsfähigkeit.
- 2015: Verschiedene Ärzte (Allgemeinmediziner, Neurologe/Psychiater) diagnostizieren eine fortgeschrittene Alzheimer-Demenz, der Erblasser wird entgültig betreut.
Verfahrensgang
- Landgericht beauftragt psychiatrischen Gutachter I, der zum Ergebnis kommt: Bereits im Juli/August 2009 lag eine Geschäftsunfähigkeit des Vaters vor. Es fehlte ihm an der Fähigkeit, die Bedeutung und Tragweite der Aufhebungsurkunde zu erfassen und rational abzuwägen.
- Oberlandesgericht Hamm bestätigt dieses Ergebnis:
- § 104 Nr. 2 BGB verlangt, dass eine Geisteskrankheit oder -schwäche den Willensbildungsprozess so stark beeinträchtigt, dass ein Betroffener nicht mehr frei von krankhaften Einflüssen entscheiden kann.
- Die mehrfach und unabhängig dokumentierten mnestischen Defizite, die Wortprotokolle der Neurologin aus Juli 2009, die Ergebnisse von Uhren- und DemTect-Tests sowie das anschließende Betreuungsgerichtsurteil sind hinreichend, um die Geschäftsunfähigkeit mit der für die Praxis erforderlichen Gewissheit festzustellen.
- Ein mögliches luzides Intervall (kurzzeitige „klare Augenblicke“) ist bei einer Alzheimer-Demenz als chronisch-progrediente Erkrankung ausgeschlossen.
Wichtigster Prüfpunkt: Beweiswürdigung bei Notarenaussagen
Das OLG Hamm betont in seiner Fortführung dieser Entscheidung (Anm. 1), dass Aussagen von Personen, die – wie der Notar – bei der Beurkundung lediglich in sozialem Kontakt mit dem Erkrankten standen und keine medizinische Qualifikation besitzen, keinen besonderen Beweiswert haben, um den Gesundheitszustand und damit die Geschäftsfähigkeit eines Demenzkranken zu beurteilen.
Begründung:
– Der Notar ist nach §§ 11 Abs. 1, 28 BeurkG nicht verpflichtet, seine eigenen medizinischen Eindrücke in der Urkunde festzuhalten, es sei denn, er hat konkrete Zweifel oder der Betroffene ist schwer krank.
– Ein Laie (auch ein Jurist) kann bei einer Demenz nicht zuverlässig erkennen, ob und in welchem Maße die Einsichts- und Urteilsfähigkeit gestört ist.
– Die hohe Lebenserfahrung der Psychiatrie hält fest, dass man dem medizinisch-juristischen Laienurteil bei solchen Krankheitsbildern nur geringe evidenzielle Bedeutung beimisst.
Folgen für die Praxis
- Wenn ein Betroffener im Rahmen eines notariellen Rechtsgeschäfts – etwa Aufhebung eines Verzichts oder Errichtung eines Testaments – bereits an einer Demenz leidet, genügt ein bloßer Vermerk in der Urkunde nicht, um seine Geschäftsfähigkeit zu belegen.
- Entscheidend sind fachärztliche Befunde, konkrete mnestische Tests, psychopathologische Gutachten und Zeugenaussagen von Fachärzten, nicht die flüchtigen Eindrücke eines Notars.
- Derjenige, der sich auf die Geschäftsunfähigkeit beruft, trägt die Beweislast und muss über Indizien oder gutachtliche Feststellungen hinaus gegenbeweisen, wenn fraglich ist, ob der Betroffene noch rational entscheiden konnte.