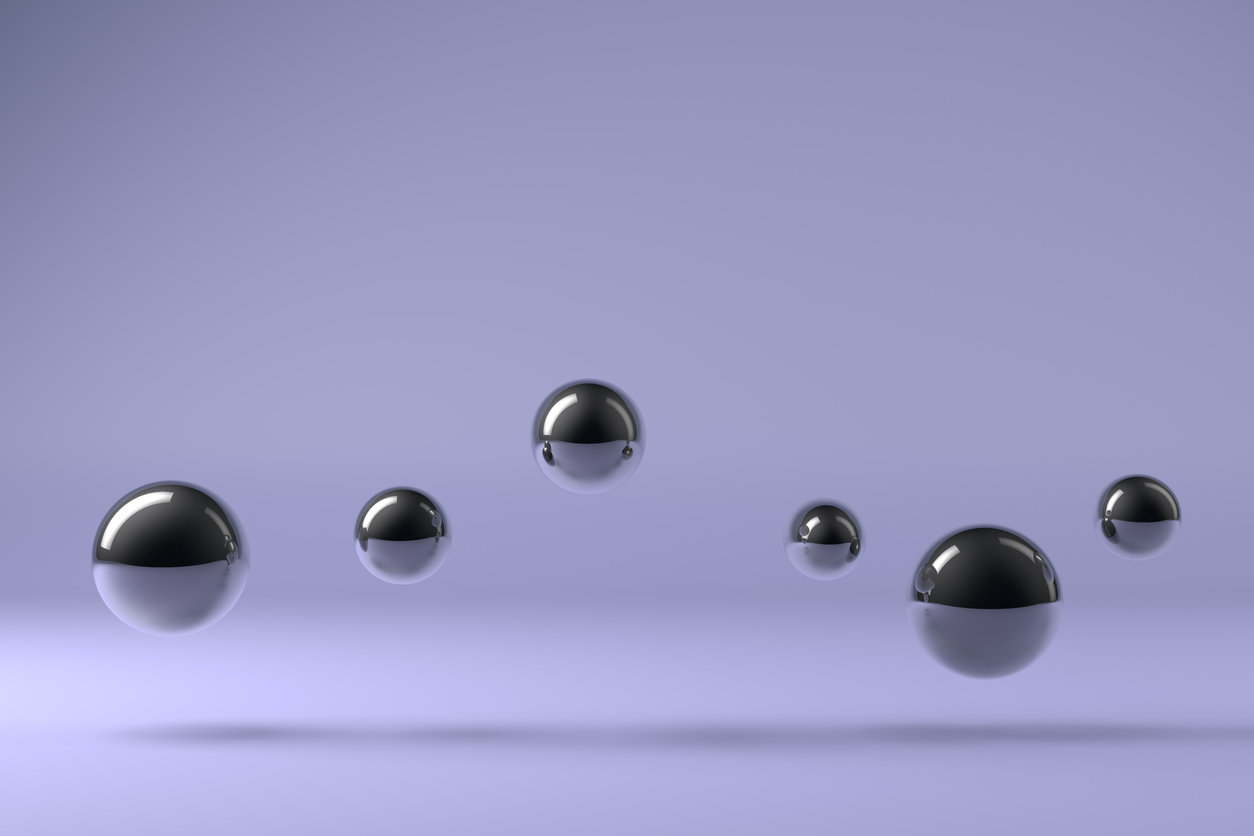BGH (VI. Zivilsenat), Beschluss vom 14.03.2017 - VI ZR 225/16:
Zur Substantiierung einer behaupteten Geschäftsunfähigkeit
BGB § 104 Nr. 2; ZPO § 51 Abs. 1; GG Art. 103 Abs. 1
In seinem Beschluss vom 14. März 2017 (VI ZR 225/16) hat der Bundesgerichtshof klargestellt, welche Anforderungen an die substantielle Darlegung und Feststellung einer Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB) in der Zivilprozessordnung (§ 51 Abs. 1 ZPO) und dem verfassungsrechtlichen Gehörsgebot (Art. 103 Abs. 1 GG) zu stellen sind. Der Senat hob das Urteil der Berufungskammer auf, weil diese den Vortrag des Klägers zur dauernden Unfähigkeit, seine Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln, nicht ausreichend gewürdigt und das von ihm angebotene Sachverständigengutachten unberechtigt abgelehnt hatte.
1. Anspruch auf rechtliches Gehör
Der BGH betont, dass das Gericht obligatorisch zu prüfen hat, ob eine Partei die im Prozess erhobene Behauptung – hier: Geschäftsunfähigkeit infolge seelischer Erkrankung – hinreichend schlüssig vorgetragen hat. Vermerkt der Kläger konkrete Tatsachen (etwa ein älterer Bericht des sozialpsychiatrischen Dienstes, der über monatelange „handlungsunfähige Phasen“ berichtet), so darf die Kammer diese Ausführungen nicht als unsubstantiiert abtun, sondern muss über den Antrag auf ein psychiatrisches Sachverständigengutachten entscheiden. Die pauschale Verneinung, der Vortrag sei „zu vage“ oder diene nur einer „Ausforschung“, verletzt das Willens- und Gehörsrecht der Partei.
2. Voraussetzungen eines § 104 Nr. 2 BGB
Eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit führt nicht automatisch zur Geschäftsunfähigkeit. Diese liegt vielmehr erst dann vor, wenn durch die Störung Einflüsse Dritter den Willen übermächtig beherrschen oder der Betroffene seine Einsichten nicht praktisch umsetzen kann. Der BGH stellt klar, dass es auf die plausible Darlegung dieser Umstände und nicht auf die abstrakte Wahrscheinlichkeit ankommt. Gelingt der Parteienvortrag, dass der Erkrankte seit Jahren in akuter Hilflosigkeit lebt und z. B. mehrfach den Strom oder die Heizung nicht hat an- oder abmelden können, muss die Kammer in Beweisaufnahme eintreten.
3. Prozessfähigkeit und Folgewirkungen
Der allgemeine Grundsatz des Art. 103 GG bindet das Gericht nicht nur in der Hauptsache, sondern auch bei der Überprüfung der Prozessfähigkeit. Nach § 51 ZPO ist das Gericht gehalten, im Zweifel einen gesetzlichen Vertreter zu bestellen, wenn eine Partei nicht selbst vortragen oder beweisen kann, weil sie geschäftsunfähig ist. Eine etwaige Unfähigkeit zur Prozessführung macht zwar die Klage oder das Rechtsmittel nicht unzulässig, wirkt sich aber auf die Prozessvertretung aus. Ferner können die Feststellungen zur Geschäftsunfähigkeit – sofern sie bestätigt werden – weit reichende materielle Wirkungen haben, etwa zur Anfechtung von Schenkungen (§ 516 BGB).
4. Zurückverweisung
Weil das Berufungsgericht den Vortrag des Klägers und sein Beweisangebot nicht ernsthaft überprüft hat, hob der BGH den Senatsbeschluss auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung zurück. Die Kammer wird nun – vorbehaltlich der Ladung eines ärztlichen Sachverständigen – den Vortrag des Klägers eingehend aufgreifen, das geplante Gutachten einholen und eine verhältnismäßige Gesamtwürdigung seiner psychischen Verfassung im maßgeblichen Zeitraum (2005–2010) vornehmen müssen.
Fazit:
Der BGH macht unmissverständlich klar, dass schwerwiegende psychiatrische Fragen in Zivilverfahren nicht durch summarische Ablehnung aufkommen dürfen. Erforderlich ist vielmehr eine sorgfältige Substantiierung des Parteivortrags und gegebenenfalls eine vertiefte gutachterliche Klärung der diagnostischen und kausalen Zusammenhänge. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Recht auf freie Willensbestimmung und der Anspruch auf faire Verfahrensführung geachtet werden.
Vorinstanzen:
AG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 02.10.2015 - 33 C 331/15 (67)
LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 04.05.2016 11 S 256/15
BGH Beschl. v. 14.3.2017 – VI ZR 225/16, BeckRS 2017, 109294